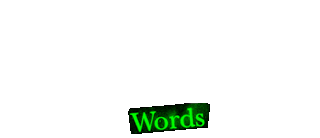01. Hans Holländer. Gedankenspiele in der Wunderkammer
Gedankenspiele in der WunderkammerHans Holländer
Sammlungen
Kuriositätensammlungen der Gegenwart werden nicht ganz zu Unrecht als moderne „Kunst- und Wunderkammern“ betrachtet, als Wiederbelebungsversuche einer verschollenen Tradition und als experimentelle Auferstehungsprogramme. Doch ist nicht zu übersehen, dass die „Wunderkammern der Avantgarde“sich von ihren Vorgängern und Vorbildern erheblich unterscheiden. „Wunder kann man sammeln“ lautet der Werbespruch eines erfolgreichen Kunsthändlers, der sich auf Dinge spezialisiert hat, wie sie damals in den Kunstkammern als besonders begehrte Objekte gesammelt und vorgezeigt wurden – subtile Arbeiten in Elfenbein, Bernstein und anderen kostbaren Materialien. Der Spruch könnte auch heißen: „Wunder kann man machen“, doch waren damals diese Arteficialia nur ein Teilgebiet neben den Naturalia und den Exotica, auch wenn es Überschneidungsbereiche gab.
In der Moderne wurden die geistreichen Kombinationen disparater Dinge dominant, wie sie zuerst 1936 in Paris in der Exposition surréaliste d' Objets1 zu sehen waren. Die Kostbarkeit des Materials spielte dabei keine Rolle. Es ging um die „poetische Zündung“ oder den geglückten Fund. Dort waren zum Beispiel die berühmte, mit Pelz überzogene Tasse nebst Untertasse und Teelöffel von Meret Oppenheim (1913-1985) und der Flaschentrockner von Marcel Duchamps (1887-1968) zu sehen. Wie die Ausstellungsphotos von Man Ray (1890-1976) dokumentieren, häuften sich in den Vitrinen mathematische Modelle, Skulpturen von Max Ernst (1891-1976) und Picasso (1881-1976), daneben seltsame und groteske Objekte, nicht wenige Zufallsprodukte, aber auch Kalauer und Bildwitze mit aktuellen Anspielungen. Das Programm ist als eine Form surrealistischer Literatur und zugleich als eine Art Spielregel für Sammler deutlich erkennbar. Das alles ist etwas Neues und etwas Anderes als die Sammlungen des 16. bis 18. Jahrhunderts, und man sieht auch, dass es sich um Gegenentwürfe zu den Ordnungsprinzipien der modernen Museen mit ihrem „Gänsemarsch der Stile“ handelt. Ganz ohne Programm, nur den eigenen Einfällen und dem Zufall folgend, entstand die Sammlung André Bretons (1896-1966), des Initiators der Ausstellung von 1936, die vor wenigen Jahren durch Auflösung und Versteigerung zerstört wurde.2 Da fanden sich allerhand exotische Objekte, Beispiele ozeanischer Kunst, Masken, Steine von Stränden, Gemälde und Zeichnungen, Skulpturen der Freunde – alles wie absichtslos angesammelt und ohne ästhetische „Auswahlkriterien“.
In der frühen Neuzeit, einem Zeitalter konkurrierender Weltbilder und einander widersprechender Erklärungsmodelle, waren die Kunst- und Wunderkammern Versuche, das „Ganze der Welt“ anschaulich in interessanten und bedeutungsvollen Dingen „aus aller Welt“ so zu präsentieren, dass universale Bezugssysteme einen Erkenntnisgewinn hervorbringen konnten. Der wichtigste Antrieb war dabei die Emanzipation der wissenschaftlichen und künstlerischen Neugierde. In den neuen avantgardistischen Kunst- und Wunderkammern der Moderne des 20. Jahrhunderts gibt es zwar weiterhin die Widersprüche der Welterklärungsmodelle, aber die Sammlungen, die ihren „Vorbildern“ so ähnlich sein sollen, folgen anderen Interessen. Mit dem Ende der universalen Sammlungen der frühen Neuzeit am Ende des 18. Jahrhunderts durch die Gründung der modernen und spezialisierten Museen unter den Denkzwängen des Historismus und der neueren Ästhetik blieben jedoch gewisse Bedürfnisse übrig, die durch die neuen Institutionen nicht befriedigt werden konnten. Die Reize des Seltsamen, Fremdartigen, Bizarren, die Abenteuer der Phantasie, die Herausforderungen durch schwer erklärliche Phänomene mit Rätseln und Geheimnissen, das alles war ein mitgeführter Mehrwert der alten Sammlungen, der übrig blieb, als die dort gezeigten Objekte verstreut oder zerstört wurden. Das Bedürfnis danach blieb quasi als subversiver Schwelbrand erhalten und brachte in den Künsten der Moderne neue, inspirierende Formen des produktiven Chaos hervor, die gegen die musealen Ordnungsprinzipen seit den Zeiten des Dadaismus und des Surrealismus ausgespielt werden konnten. Damit kehrte durch die Hintertür in die Kunstgeschichte zurück, was vor zwei Jahrhunderten aus ihr hinausgeworfen worden war (frei nach Horaz: Naturam expellas furca, tamen usque recurret.3)
Viele moderne Kunst- und Wunderkammern befinden sich seit dadaistischen Zeiten oft fast ausschließlich auf dem Papier – als Serie von Collagen, Kombinationen aus Fragmenten von Abbildungen, die meist aus Büchern stammen. Max Ernst war seit den zwanziger Jahren der wohl produktivste Meister der kombinatorischen Vermehrung seltsamer Phänomene durch die Collagetechnik mit ihren unerschöpflichen Begegnungen disparater Dinge „auf einer dafür nicht geeigneten Ebene“, bei denen der „Funke überspringt“.4
Dieser Begegnungen und poetischen Funkenflüge bedürfen nicht unbedingt der materiellen Bestandteile, seien es Bildfragmente oder Gegenstände, die man verfremdend montieren kann. Schon ihre Existenz als Gedankenspiel ist ausreichend und überzeugend bei entsprechender literarischer Qualität. Eine der interessantesten Wunderkammern der neueren „Produktion“ ist die von Laurence Weschler erfundene, beschriebene und kommentierte des Mr. Wilson.5 Diese Wunderkammer ist ein Buch. Es gibt vor, eine wirklich existierende Sammlung zu beschreiben, bietet auch hinreichende Informationen zu ihrer Lokalisierung in San Francisco, und doch ist alles nur als Text gegenwärtig.
Die auch mit dieser sich an älteren Beschreibungen und Inventaren orientierenden Erfindung einhergehende Rehabilitierung und neue Wertschätzung der alten Sammlungen durch ein neues Verständnis ihrer Strukuren und Ziele täuscht jedoch nicht darüber hinweg, dass die neuen Kunst- und Wunderkammern etwas anderes sind als die alten. Für die Künstler der Moderne ist das Zentrum der Welt und ihrer Aufmerksamkeit das eigene Selbst. Insofern sind sie entschiedene Ptolemäer. Das Bild ihres Kosmos und damit die Gestalt der Sammlungen hängt von individuellen Entscheidungen und subjektiven Perspektiven ab, die zwar schon immer bei Künstlern und Sammlern im Spiel waren; heute jedoch sind sie es ohne Einschränkungen und objektive Legitimitätsinstanzen. Diese Entwicklungen haben zu einer erstaunlichen Mannigfaltigeit neuer Sammungen und Privatmuseen geführt. Zum Beispiel gibt es gibt es Sammler, die sich auf die seltenen Dinge spezialisieren, die in den Kunst- und Wunderkammern präsentiert wurden, gleichzeitig aber an den Rändern der neueren Kunstproduktion nach extravaganten Erfindungen suchen, um eine neue „Kunst- und Wundercollection“ zu schaffen. Diese Multi-Perspektivität ist ein Merkmal der Sammlung Olbricht.
Es waren freilich nicht nur die Reize des Seltsamen und Irregulären, die das Ende der Kunst- und Wunderkammern überlebten und als konstantes Bedürfnis nach neuen Formen drängten, denn innerhalb der Kunstkammern Entwicklungen begonnen, die zu neuen Erfindungen und zur beständigen Suche nach Problemlösungen vor allem in den physikalischen Künsten, in Optik und Mechanik, führten und ganz unabhängig von ästhetischen Doktrinen die Phantasie beflügelten. Dazu gehören auch geniale Täuschungsmanöver wie der schachspielende Türke des Freiherrn von Kempelen6 und die Erzählungen E.T.A. Hoffmanns von den Automaten und der Dämonie der Vortäuschung von Leben durch Mechanik.7 In den Kunstkammern waren das besondere Attraktionen, ihre „technischen Wunder“, und diese Faszination ist als artistisch-technische Konstante bis in die Gegenwart mit ihren unbesiegbaren Schachcomputern und einer immer weitere Bereiche erobernden Kybernetik samt einer phantastischen Roboterliteratur geblieben. Auch sie kann man zu den Spätfolgen früherer Synthesen aus Wunderkammer und romantischer Literatur zählen. Ein Kompendium zukünftiger Möglichkeitswelten ist zum Beispiel das monströse Gedankenspiel Summa Technologia von Stanislaw Lem, einem Meister der Künste und Wunder.8
Betrachtet man nun nach alledem die 2010/2011 erschienene Publikation zu einer Ausstellung „post-surrealistischer Kunst“ der Hamburger Galerie Thomas Levy9, die auf der Pariser Ausstellung von 1936 zu beruhen behauptet, gewinnt man allerdings den Eindruck, dass die vor allem in jüngerer Zeit entstandenen Objekte, Montagen und Fundstücke in ihren modernen Vitrinen weniger an die im Vorwort beschworenen alten Kunst- und Wunderkammern erinnern als vielmehr an Parodien dieser Sammlungen, die als literarische Spott-Inventare schon frühzeitig in der Nachbarschaft der Nonsens-Poesie erfunden wurden, und deren Geschichte bereits zu einer Zeit begann, als die Kunst- und Wunderkammern noch in voller Blüte standen, aber auch durch skurrile Merkmale zu satirischen Gedankenspielen und Beschreibungen imaginärer Kabinette aufforderten. Ein besonders schönes fiktives Inventar dieser Art stammt von Grimmelshausen (1621-1676). Er hat diese Parodie im Anhang zur zweiten Auflage der deutschen Übersetzung des Mondromans von Francis Godwin 1667 publiziert.10 Der Titel verspricht Etliche wunderliche Antiquitäten, welche der fliegende Wandersmann in einem entlegenen Schloss am Meer, das von Türken bewohnt ist, gesehen und verzeichnet hat. Diese Altertümer werden überwiegend mit bekannten Personen und Ereignissen aus dem Alten Testament, zu einem kleineren Teil aus dem Neuen Testament in Zusammenhang gebracht. Der Witz besteht darin, dass es sich um ganz alltägliche Dinge oder Erfahrungen handelt, die durch die willkürliche Zuordnung ehrwürdige Bedeutung gewinnen. So gibt es in der Sammlung ein Stück von der Haut der Schlange, die Eva im Paradies verführte – dieses Objekt hat auch Weschler in seinem Inventar genannt – und ein Stück von dem Feigenblatt, mit dem Eva sich bedeckte. Auch der Misthaufen, auf dem Hiob die unbegreiflichen Prüfungen seines Gottes erduldete, konnte besichtigt werden, und sogar ein Stück vom Regenbogen nach dem Ende der Sintflut wurde verzeichnet. Das Spiel mit der Komik des Heiligen ist eine Anspielung auf die Absurdität der Reliquien-Sammlungen und zugleich der Leidenschaft der Sammler.
Gegen Ende der „Blütezeit“ der Kunst-und Wunderkammern erfand Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799) das Inventar der Sammlung eines Engländers, der wegen seiner ausufernden Sammelleidenschaft und seiner Leichtgläubigkeit, mit der er auf Fälschungen hereinfiel, berüchtigt gewesen sei. Spöttisch habe man ihn Hans Sloane genannt, weil er sich mit diesem großen Sammler verglichen habe. Sein Inventar trägt den Titel Verzeichnis einer Sammlung von Gerätschaften, welche in dem Hause des Sir H. S. künftige Woche öffentlich verauktioniert werden sollen.11 Lichtenberg gibt vor, das Verzeichnis in säuberlicher Schrift auf den Leerseiten einer Ausgabe der Werke von Swift gefunden zu haben. Unter der Überschrift habe in Parenthese in the manner of Dr. Swift gestanden. Diese „Manier“ sei in der Satire gut getroffen, meint – also sich selbst lobend – ihr Autor Lichtenberg.
An absurden Gegenständen ist in diesem Inventar kein Mangel. Schon das erste Stück ist „ein Messer ohne Klinge, an welchem der Stiel fehlt“. Der Auktionator hatte damit ein ernsthaftes Problem, denn wie sollte er diesen offensichtlich nicht existierenden Gegenstand verauktionieren? Ein „doppelter Kinderlöffel für Zwillinge“ ist das nächste Objekt. Nach diesen Anfängen geht es in rascher Progression einer exponentiellen Steigerungskurve bis zu Materialisierungen gewaltiger Spleens. Bei Nr. 6 befindet man sich noch im kleineren Format einer Schachtel mit fein gearbeiteten Patronen zur Sprengung hohler Zähne. Für größeren Schießpulver-Bedarf empfiehlt sich Nr. 16 mit einer von einem Pudel angetriebenen Pulvermühle. Sehr schön ist auch das Angebot von „teils verbotenen, teils verrufenen Büchern“ mit Kupferstichen von „obszöner Schönheit“ zum Gebrauch der Jugend, um sich in der Kirche zu amüsieren. Ein besonderes Erlebnis dürfte auch die „Peinliche Halsgerichtsordnung von dem Seeligen selbst in Musik gesetzt“ geboten haben. In der Partitur geht es mit Pauken und Trompeten und sogar mit Kanonenschüssen ziemlich lautstark zu. Eine besondere Abteilung ist einer Sammlung von Trauergeräten gewidmet, in der Lichtenberg seinen makabren Humor mit den Varianten der Farbe „Schwarz“ spielen lässt. Mit diesen Beispielen, der biblischen Groteske Grimmelshausens und den Variationen Lichtenbergs über einen Spleen, wird buchstäblich noch zu ihren Lebzeiten die Kunst- und Wunderkammer zu einer literarischen Groteske und zu einem Theatrum des Absurden. Das sind frühe Vorspiele surrealer Sammlungstätigkeit und moderner Fortsetzungen alter Sammlungsformen, die sich den ästhetischen und moralischen Ordnungsreglements der Museen verweigern.
Loreto
Wer heutzutage beabsichtigt, seinen Interessen folgend Dinge zu sammeln, die für ihn eine gewisse Bedeutung haben und in denen sich seine Gedanken – vielleicht – spiegeln, kennt häufig die früheren Unternehmungen von zumeist fürstlichen Sammlern, eine Welt oder vielleicht sogar „die Welt“ um sich herum zu bauen: als Theatrum oder auch als Labyrinth, als Kunst- und Wunderkammer. Wer in analoger Weise seine Künste und Wunder entwerfen, erfinden oder anhäufen will, befindet sich unvermeidlich in einer imaginären Konkurrenz zu den alten Sammlern. Wenn der Betreffende Glück hat, begegnet er einem Ensemble in halbwegs intaktem oder geschickt wiederhergestelltem Zustand, das einiges aus der Epoche der Kunstkammern enthält. Er kann dann seine Betrachtungen und Einfälle in Gestalt einer Parallelwelt oder eines bildhaften Kommentars quasi als Analogsammlung entwerfen und zu einigen Objekten moderne Äquivalente schaffen. Eine dafür geeignete alte Sammlung ist der Loreto-Schatz. Für Josef Rainer war er eine willkommene Inspiration zur Erfindung seiner kommentierenden Dinge. Dieser Schatz ist kein Kuriosenkabinett, aber wie so viele Schätze hat er eine kuriose Geschichte, in der auch Wunder vorkommen. Sein Name geht auf die Loreto-Legende zurück. Sie handelt von der Wanderung eines heiligen Ortes. Das Geburtshaus Marias wurde ursprünglich in Nazareth verehrt. Nach der Eroberung der Stadt durch die Araber fand ein erstaunlicher Transport statt: Engel trugen das Haus nach Loreto und errichteten es dort „originalgetreu“ aus den alten Materialien. In der Folge entstanden an mehreren Orten weitere Nachbildungen, die den gleichen Anspruch auf Verehrung hatten wie das ursprüngliche Bauwerk. Der Loreto-Schatz gehört zur Ausstattung des von der spanischen Königin Maria Anna (von Österreich, 1667-1740) gegründeten Kapuzinerklosters und der von ihr gestifteten Loreto-Kapelle. Mit seiner Stiftung folgte sie einer Bitte ihres in Klausen geborenen Beichtvaters, der dem Kapuzinerorden angehörte und ihr nach Madrid gefolgt war, und schenkte, neben Büchern geistlichen und weltlichen Inhalts, religiösen Utensilien, Textilien und Keramik, auch Gemälde von Meistern des 17. Jahrhunderts und mechanische Kunstwerke wie eine barocke Uhr. Der „Schatz“ bot genügend Gelegenheit, sich mit neuen Ideen kommentierend einzufädeln und einen „Überbau“ auf dieser Basis zu errichten. Nach einem Raub längere Zeit verstreut und verschollen, jedoch in Italien wiedergefunden, wurde er kürzlich im Klausener Museum ausgestellt, und zwar zusammen mit den von einigen Objekten angeregten Werken von Josef Rainer: Reflexionen über mehrere Jahrhunderte zeitlicher Distanz, Spiegelungen alter Themen in einem heutigen Bewusstsein, die das Überlieferte teils ergänzen, teils interpretieren oder kommentieren. Zum Beispiel konnte die prächtig-barocke Uhr nicht nur auf die Zeitlichkeit allen Menschenwerks verweisen, sondern auch auf die große Bedeutung der Spielwerke und Roboter in den Künsten der Neuzeit und auf die modernen, beträchtlich erweiterten Möglichkeiten von Automaten, die Rainer seinen Figuren „implantiert“.
Auf den Verlust einer wertvollen chinesischen Schale aus der Ming-Dynastie verweist Rainer mit einem Ensemble von blau dekorierten Keramikschüsselchen. Einige der alten Bücher, denen man die Spuren der Zeit ansieht, bekamen neue Bücherstützen in Gestalt eines Affen und eines Papageis. Porträts der Königin Maria Anna, ihres Gemahls Karl II. und des Kapuzinerpaters Gabriel folgen zwar den alten, im Schatz vorhandenen Bildnissen, bekommen nun aber ornamentale Begleitung: So verwandelt sich der Körper des Königs in ein Bündel von Pfefferschoten; sie sind ein Schutzzauber gegen Verrücktheit. Aus einem gewebten Antependium stammen die vegetabilen Ornamente mit Vögeln im Porträt der Königin, und den Kapuzinerpater umgibt eine Wolke kleiner Teufelchen, vielleicht ein Hinweis auf Versuchungen, denen der Pater standhaft Widerstand leistete.
Natürlich sind auch diejenigen Themen, mit denen sich der Künstler ganz unabhängig von Loreto und seinem Schatz beschäftigt, ein Teil seiner kommentierenden Zeitreise an den Rändern der alten Kunstkammern. Dazu gehört das Nachdenken über das komplizierte Verhältnis von Mensch, Tier und Maschine am Beispiel von Automaten und Affen.
Automaten
Die alten Kunstkammern sollten Staunen und Bewunderung erregen, und das nicht nur durch die Präsentation von Dingen, die ebenso kostbar wie fremdartig waren, sondern auch durch die neuesten Erfindungen der Technik aus Optik und Mechanik. Daher waren die Automatenfiguren mit ihren Bewegungsformen besondere Attraktionen, zumal dann, wenn sie auf Musikinstrumenten nach eingebautem Programm ihre Melodien spielten. Das waren Meisterwerke der Präzision im Zusammenspiel mehrerer Mechanismen, dem Uhrwerk, den Blasebälgen und der Schablone, die das An- und Abschalten regelte. Diese Automaten konnte große Orgeln sein, die mit Wasserrädern angetrieben wurden, wie man es bei Salomon de Caus sieht.12 In kleinerem Format ahmten diese technischen Wunderwerke menschliche Tätigkeiten nach und täuschten Lebendigkeit vor, gemäß dem Satz von Leonardo da Vinci: „Die Bewegung ist Ursache jeden Lebens“ (Il moto è causa d' ogni vita).13 Der Anschein von Lebendigkeit von offensichtlich mechanischen Gebilden aus anorganischen Materialien kann verblüffend wirken, und das war auch immer beabsichtigt. Mit zunehmender Perfektion kann sich jedoch auch ein Gefühl des Gespenstischen, ja Grausigen einstellen. Das wurde dann seit dem späten 18. Jahrhundert ein romantisches Thema, das in den Erzählungen E.T.A. Hoffmanns kulminierte. Bis heute, im 20. Jahrhundert geradezu eskalierend, wird das Spiel mit der Doppeldeutigkeit des „toten Lebens“ der Automaten, der Roboter, in zahlreichen einschlägigen Geschichten fast schon schon zu einem Bestandteil des Alltäglichen. Wenn einerseits die Nachahmung der Oberflächen menschlicher Körper, der lebendigen Haut, durch Kunststoffe immer täuschender gelingt, muss andererseits ein tatsächlich sich bewegender Roboter nicht mehr zum Androiden werden. Er kann metallisch glänzen und seine Mechanik, etwa die Mechanik der menschlichen Hand in Metall, offen vorzeigen und wird dadurch Bewunderung erregen. Auch der moderne Schachcomputer muss sich nicht mehr als „Türke“ verkleiden und ist auch keine raffinierte Vortäuschung von automatisch funktionierender Intelligenz mehr. Die steckt nun in seinen Zügen und ist auf dem Schachbrett zu sehen. Der Freiherr von Kempelen, der den Schachtürken erfand, war indessen ein auf mehreren Gebieten erfinderischer Mann, dessen Ziel darin bestand, die menschliche Stimme mit einem dafür geeigneten Mechanismus nachzuahmen, was ihm schließlich auch gelang.14
Die heutigen Künstler befinden sich in einer sonderbaren Situation, wenn sie sich mit dem alten und allzu modernen Thema der „Automaten-Lebendigkeit“ auseinandersetzen wollen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, die alte „Wunderkammermelodie“ weiter zu spielen. Eine der Varianten wäre zum Beispiel die Weiterentwicklung der schon im 17. Jahrhundert ziemlich raffinierten Technik der Porträts in farbigem Wachs mit Hilfe neuer Materialien. Josef Rainer hat einen anderen Weg eingeschlagen und zugleich eine früher noch nicht mögliche und heute anscheinend nur selten gewählte Kombination gewählt. Seine redenden Büsten sind keine Roboter, Androiden oder Automaten. Ihre Lebendigkeit gewinnen sie durch die Sprache,wobei sie allerdings auch die Lippen bewegen können und vielleicht auch die Augen. Sie sind aus Gips, täuschen nichts anderes vor, sind innen hohl, damit das „Sprechgerät“ und die übrigen Vorrichtungen zum An- und Abschalten untergebracht werden können. Die Gipsbüsten sind nur teilweise bemalt: Haare, Augen, Kleidung, aber überwiegend gipsweiß. Eine davon stellt Kaiser Ferdinand III. (1608-1657) dar, einen der Herrscher aus der Blütezeit der Kunst- und Wunderkammern, womit Rainer eine Quelle seiner Anregungen zu erkennen gibt. Die Haare, die die Augenbrauen, der sorgfältig und scharf konturierte Schnurr- und Spitzbart heben sich pechschwarz von dem weißen Gipsgrund ab. Mit seinen spitzen Bartenden gewinnt der Fürst eine gewisse Ähnlichkeit mit Salvador Dali. Das mag beabsichtigt sein. Wie kommt nun die Sprache ins Spiel? Rainer beschreibt, was geschieht: „Sobald man den Sockel betritt (gemeint ist die Bodenplatte unter dem Sockel), und dem Kaiser Gedichte vorträgt, beziehungsweise mit ihm ins Gespräch kommt, antwortet er, lobt den Beschauer.“ Da der Kaiser zugleich eine Kunstfigur ist,kann der Betrachter sich vorstellen, er befinde sich in einem Dialog mit dem Kunstwerk. Rainer hat mehrere dieser Sprechbüsten gemacht. In einer von ihnen stellt er sich selbst als Jungen dar, und zwar in Erinnerung an eine ganz bestimmte Situation: „Josef Rainer in der Schule“. Er schreibt dazu: „Diese lebensgroße Büste verdreht in regelmäßigen Abständen die Augen und kippt den Kopf, während ich aus meinem Italienisch Volksschulheft vorlese und von der Italienischlehrerin verbessert werde.“ Der Betrachter erlebt eine zweifellos seltsame Begegnung mit dem Problem Sprache oder besser mit der Fremdheit von Sprache.
Affen und Menschen
Affen sind wegen ihrer Menschenähnlichkeit und der Affenähnlichkeit des Menschen ständige Begleiter der Kulturgeschichte gewesen. Sie sind mit ihrer Geschicklichkeit der Körperbeherrschung in vielen „Sportarten“ staunenswert, darüber hinaus bereichern sie das menschliche Schimpfwort-Vokabular und sorgen für Metaphern, in denen ihr imitierendes Talent eine Rolle spielt. So heißt es oft, die Künstler seien die „Affen der Natur“, weil die „Nachahmung der Natur“ in den Künsten seit langem eine Rolle spielte und spielt. Den Affen fehlt nur wenig, um Mensch zu sein. Für welchen Affen man sich entscheidet, ist Ansichts- und Geschmackssache. In Frage kommen für literarische und künstlerische Rollen vor allem die vier bekanntesten Primaten:
der Gorilla
der Gibbon
der Schimpanse und
der Orang-Utan.
Der Gorilla ist der mächtigste der Affen, der Schwergewichtsmeister, die archetypische Figur des CHEFS. Er ist bedeutend, strahlt Bedeutung aus und verkörpert ganz buchstäblich Bedeutung. Mit den Details hält er sich nicht weiter auf. Gelegentlich bedient er sich seiner Macht, wächst zu ungeheurer Größe, wird zum Schrecken der Wolkenkratzer. Da sich seine Bedeutung auch in männlicher Überlegenheit konzentriert, gibt er seinen einschlägigen Trieben nach und tritt als Frauenräuber auf. Seine Umarmungen sind zwar liebevoll, gelten aber als unangenehm. Daher sind Gorillas auch Freistilringer, Bodyguards von Gangsterbossen und Türsteher gewisser Clubs, dies freilich nur metaphorisch. Ich indessen erinnere mich an einen überaus eindrucksvollen Herrn, der im Schneidersitz in seinem Käfig thronte und voller Verachtung das Gewimmel der Zuschauer beobachtete, wobei er – ganz der Boss – lässig im Mundwinkel einen Strohhalm balancierte.
Zu erwähnen sind nun die Gibbons. Es mag sein, dass auch sie ein mimisches Talent haben, aber sie nutzen es nicht zur Demonstration der Gewalt oder der Philosophie oder der List, sie sind wirkliche Künstler, Musiker, und zwar Sänger. Am frühen Morgen und bei abendlicher Dämmerung versammeln sie sich und stimmen ihre Lieder an, die überaus melodisch und erfindungsreich sein sollen und in China seit ältesten Zeiten bewundert werden. Sie sind zu virtuosen Tonfolgen fähig, die von menschlichen Stimmen erst nach langer Übung erreicht werden. Robert van Gulik, der große Sinologe, hat ihnen einen bewundernden Essay gewidmet15 und beschrieben, was er hörte und sah, denn als Diplomat der niederländischen Regierung hielt er sich viele Jahre in Ostasien auf und lebte mit Gibbons zusammen. Diese freundlichen Artisten sind vielleicht die menschlichsten unter allen Primaten, einschließlich der Menschen selber, und immer waren sie hochgeachtet. In der chinesischen Literatur gehören sie zu den magisch begabten Lebewesen, die sich immer wieder in Menschen verwandeln können.
Der Schimpanse ist der „Affe schlechthin“. Er gilt vielen als schlau, er wird am häufigsten als Imitator menschlicher Fertigkeiten zitiert, er kann auch mogeln und ist ein geschickter Handtaschendieb. Für die menschliche Sprache ist sein Kehlkopf nicht geeignet, doch man kann ihm die Taubstummensprache beibringen. Mit diesem Vokabular geht er auch recht erfinderisch um. So wurde von einem gelehrigen Schimpansen berichtet, dass er Schimpfwörter gebrauchte, sogar unanständige, die man ihm angeblich mit Sicherheit nicht beigebracht hatte.
Die Verwandtschaft zwischen Affe und Mensch hat schon immer die Frage nach den Mischungs-Verhältnissen der tierischen und menschlichen Eigenschaften ausgelöst. Wieviel Mensch steckt im Affen, wieviel Affe im Menschen? Die offenkundige Geschicklichkeit der Affen, ihr Nachahmungstrieb und eine auf ihre Bedürfnisse eingespielte Intelligenz wurden aufmerksam, aber auch ironisch, spöttisch und vielleicht auch neidisch beobachtet. Auch die Frage „was wäre,wenn die Affen auch sprechen könnten?“ wurde gestellt: Wären sie dann nicht eigentlich Menschen, die nur etwas anders aussehen als wir? Es erweist sich, dass die Sprache das entscheidende Vermögen des Menschen ist, das den Unterschied begründet.
Josef Rainer bevorzugt den Orang Utan, denn dieser Affe ist physiognomisch dem Menschen am ähnlichsten, besonders wenn er in aufmerksamer Versunkenheit nachdenklich sein Haupt auf die Hand stützt. Er denkt. Er sieht philosophischer aus als alle anderen Primaten. Was er denkt,verrät er nicht. Es wird etwas Tiefsinniges sein, vielleicht die nicht entscheidbare Frage: „Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts?“, oder er versucht zu ergründen, wer er sei. Sein Orang-Utan hält eine kluge Rede zu diesem Thema, und dank der Mechanismen in seinem Schädel kann er sie auch wirklich selber halten. Der philosophische Affe ist mit dieser Wortmächtigkeit auch ein Poet, und natürlich bewegt er sich auf der Spur von René Descartes („je pense – donc je suis“), denn dass er denkt, hat dieser Denker gewiss herausgefunden, und das sichert auch ihm das Bewusstsein seiner Existenz. Ob er als Affe existiert oder als Mensch, ist dabei eine sekundäre Frage.
Die Nähe zur Literatur und daher zu Büchern war es wohl, die Rainer bewogen hat, dem Orang-Utan die verantwortungsvolle Tätigkeit als Bücherstütze zuzuteilen. Die Bücher, die zwischen Stützen aufrecht stehen, sind alt und verschlissen. Sie sind auf die hilfreichen Primaten angewiesen. Es handelt sich um theologische Abhandlungen und Lehrbücher über das anständige Benehmen von Fürsten aus dem Loreto-Schatz, der Stiftung aus Spanien, wo Bücher dieses Inhalts gewiss reichlich vorhanden und entbehrlich waren und daher anderen frommen Verwendungen in einem Museum zugeführt werden konnten. Dort wurde dann auch für die Stützen gesorgt. Der hilfreiche Affe blickt durch ein Teleskop zum Himmel, sei es, weil er erraten hat, welche Bücher er bewacht, sei es, dass er sich tatsächlich für die Sterne interessiert und etwas vom Planet der Affen gehört hat, den man irgendwo im Universum vermuten darf. Damit befände er sich auf einer literarischen Spur, denn das Universum ist lesbar, und das Teleskop ist eine Lesehilfe. Auf eine andere solche Spur weist die Tafel mit der Devise des Affen: ars simia naturae, durch die er zum Künstler wird. Dass die Kunst eine weltbeherrschende und weltbesitzende Macht ist, erkennt man daran, dass er auf einer Weltkugel sitzt.
Dem wissbegierigen Künstler-Affen gegenüber sitzt auf der zweiten Buchstütze ein Papagei. Er ist bunt, so wie man es gewohnt ist, und der riesige Schnabel steht ihm wie eine Kneifzange. Seine bemerkenswerteste Fähigkeit ist das Sprechen. Er kann laut und verständlich Wörter und Sätze wohlartikuliert wiedergeben, die er aufgeschnappt hat und die er stundenlang wiederholt. Aber er weiß nicht, was sie bedeuten, oder sie bedeuten für ihn etwas, was wir nicht wissen können. Anscheinend benötigt er sie, vielleicht ist es eine nur ihm bekannte Geheimsprache. Denn für die Verständigung unter seinesgleichen hat er ja eine andere Sprache, die gelegentlich in ein unerträgliches nervenzersägendes Kreischen übergeht. Er ist sozusagen zweisprachig, und wir müssen annehmen, dass er beide benötigt, um anzuzeigen, dass es ihn gibt: „Ich rede, also bin ich!“ Ob das Reden mit irgendeiner Art von Denken einhergeht, verrät er uns nicht. Wenn er die Bücher, die er stützt, auch lesen könnte, dann wüssten wir vielleicht etwas mehr. Seine Devise heißt: „docti viri male pingunt“ (Gelehrte malen/schreiben schlecht). Rainer interpretiert den Satz so: „Der Fachspezialist übersieht viel Wesentliches und vergisst auf die Zusammenhänge.“
Affen wie Menschen neigen zu gewissen Formen umtriebiger Geschäftigkeit, deren Sinn sich hinter einem Ausdruck ungeheurer Wichtigkeit versteckt. Man ist in Eile oder täuscht Eile vor und, was immer geschieht,es duldet keine Unterbrechung. Aus der menschlichen Perspektive gesehen, befindet sich der emsige Affe in einem Spiel, das nur er versteht oder zu verstehen vorgibt, auch wenn das Spielzeug ein nur für den menschlichen Gebrauch bestimmter Gegenstand ist. Wenn es sich zum Beispiel um eine Schreibmaschine handelt, dann wird der kluge Primate sie als Herausforderung seines Nachahmungstriebes betrachten und das tun, was Menschen mit einer Schreibmaschine tun. Er wird tippen, und wenn es ihm Spaß macht, wird er damit nicht freiwillig aufhören. Auch der dabei entstehende Krach wird ihm gefallen. Wenn dieser Affe auch noch unsterblich wäre, die Schreibmaschine unverwüstlich und die Reserven an Schreibpapier unerschöpflich, dann würde er eine endlose Folge von Zufallskombinationen des Alphabets auf das Papier werfen, und ganz zufällig würden dabei auch alle überhaupt möglichen Texte entstehen, einschließlich aller vergangenen und zukünftigen Werke der Weltliteratur. Noch sehr viel größer würde die Menge der völlig unbrauchbaren Buchstabenfolgen sein, doch dem unsterblichen Affen wäre das gleichgültig, weil er nicht weiß, dass er damit beschäftigt ist, eine Universalbibliothek in der Größenordnung des Universums zu entwerfen. Er weiß auch nicht, dass die Geschichte dieser monströsen Bibliothek im frühen 17. Jahrhundert mit dem Wiener Mathematikprofessor Paul Guldin (1577-1643) beginnt und über Leibniz und Curd Laßwitz (1848-1910)16 zu Jorge Luis Borges (1899-1986)17 gelangte. Sie alle spielten mit der Menge von Kombinationen der Buchstaben des Alphabets und ihrer erstaunlichen Progression. Der Affe ist, quasi als lebender Zufallsgenerator, erst im 19. Jahrhundert in dieses Gedankenspiel geraten, und zwar, wie berichtet wird, bald nach der Publikation der Evolutionstheorie von Charles Darwin. In einer Diskussion soll der Biologe Thomas Huxley (1825-1895) die Evolution der Lebewesen aus der ständigen Kombination der Moleküle über lange Zeitspannen mit der Entstehung von Texten aus der endlosen Kombination von Buchstaben nach dem Zufallsprinzip verglichen haben. Zum Beispiel würden sechs unsterbliche Affen, die wahllos auf sechs niemals versagenden Schreibmaschinen tippten, alle Bücher der Weltliteratur produzieren. Borges, der die Anekdote zitiert, merkt an, dass ein einziger unsterblicher Affe ausreichend sei. In der Überlieferung wird die Anzahl der tippenden Affen unterschiedlich angegeben. Das ist jedoch gleichgültig, indessen wird bezweifelt, dass Huxley den Ausspruch wirklich im Jahre 1860 getan habe, weil die Schreibmaschine damals noch gar nicht erfunden gewesen sei.18
Interessant ist der Vergleich der Moleküle mit den Buchstaben des Alphabets, der nicht neu ist, weil schon Pierre Gassendi (1592-1655) damit seine Grundlagen der Chemie beschrieben hat.19 Bei Huxley sind die lebenden Organismen vergleichbar mit sinnvollen Texten. Die Voraussetzungen sind die Kombinatorik und ein endloser Zeitrahmen. Die besondere Pointe dieses Infinity-Monkey-Theorems besteht aber nun darin, dass Huxley – oder wer auch immer – die Arbeit an der Schreibmaschine den Affen übertragen hat, also eben dem Tier, das in den Jahren nach der Publikation der Theorie Darwins die populären Diskussionen über die Abstammungslehre mit dem Satz: DER MENSCH STAMMT VOM AFFEN AB beherrschte, der bei einschlägig programmierten Gemütern äußerstes Ärgernis erregte, zum Beispiel deswegen, weil er im Widerspruch zur biblischen Lehre stand, gemäß der Gott den Menschen nach seinem Bilde erschaffen habe. Diese besondere Heraushebung des Menschen war damit hinfällig, und auch der Schöpfer war nun, wie Huxley betonte, eine unnötige Annahme, weil der Zufall völlig ausreichend sei.
Der Affe setzt also in dem Gleichnis den universalen Zufall in seine legitimen Rechte ein, vertritt – blindlings tippend – alle Poeten der Welt und ist ein Stellvertreter der unablässig alles Leben und alle Dinge hervorbringenden Natur, die auch ihn selber und natürlich auch den von ihm abstammenden Menschen erschaffen hat und erschafft. Dieser Affe ist sicher ein Darwinscher Affe. Zu welcher Spezies er gehört, wird nicht gesagt, aber wahrscheinlich dachte der Autor der Anekdote, nehmen wir an, es sei wirklich Huxley gewesen, an den Affen schlechthin, den Allerweltsaffen, also den Schimpansen.
Minotaurus
Der Tier-Mensch-Vergleich hat eine lange und alte Geschichte bis zurück in archaische Religionen und Rituale und ist in allen Mythologien präsent. Vor allem die zahlreichen Mischwesen sind ja immer auch Kombinationen von Eigenschaften, von Vorzügen und Mängeln. Ein sehr berühmtes Exemplar einer unguten Mischung ist der Minotaurus, der stierköpfige Menschenleib. Er war das Resultat einer widernatürlichen Liebe der Pasiphaë, der Gemahlin des Königs Minos von Kreta, zu einem dem Meer entstiegenen göttlichen Stier, einer Gestalt des Poseidon. Damit dieVereinigung stattfinden konnte, baute Daidalos ein künstliche Kuh, in der die Dame den Stier erwartete. Sie gebar ein Monstrum, das im Hause Minos als Katastrophe empfunden und vor der Welt verborgen wurde. Man sperrte den Stiermenschen in das von Daidalos erbaute Labyrinth, aus dem es keinen Ausweg gab. Diese Situation des Monstrums in einem architektonischen Ungeheuer kann Anlass zu allerhand Überlegungen sein. Denn der Stiermensch hat mit seinem Rinderverstand keine Möglichkeit, zu begreifen, was ihm widerfahren ist. Was also sieht und empfindet er? Gefährlich ist er, denn seine Stiernatur ist dominant. Auch ist er ein Kannibale, denn ihm werden Menschen zugeführt, die er frisst oder zumindest tötet. Einer besiegt ihn am Ende – Theseus, den der Faden der Ariadne wieder zum Ausgang des Labyrinths führt.
Rainer beschreibt die Entstehung seines Minotaurus so:
„Den Körper des Minotaurus habe ich während meines Studiums in München modelliert und in Gips gegossen. Es fehlten aber Kopf und Arme. So machte ich diese neu, jedoch gab ich der Figur einen Stierkopf. Der Minotaurus liegt im Raum, während aus Lautsprechern eine eingelesene Version von Friedrich Dürrenmatts Text Minotaurus zu hören ist.“
Wieder geht es um Sprache. Dürrenmatt20 schildert die Welt des Minotaurus,das Labyrinth aus der Perspektive des Gefangenen, der seine Wahrnehmungen nicht in Begriffe fassen kann. Er sieht und denkt in Bildern, die er zwar genau erkennt, aber nicht versteht, zumal da das Labyrinth ein Spiegellabyrinth ist, in dem der Minotaurus von einer endlosen Folge von Spiegelbildern seiner selbst umgeben ist, die alle seine Bewegungen wiederholen, bis am Ende ein „Minotaurus“ auftaucht, der kein Spiegelbild ist. Auch er führt alle Bewegungen aus, jedoch nicht in Echtzeit, sondern mit einer ganz geringen Verzögerung. Daran sieht der Stierköpfige, dass er nicht mehr allein ist: Es gibt noch einen anderen Minotaurus. Sein Freudentanz wird jäh beendet. Der „Andere“ zieht einen Dolch und sticht zu. Es ist Theseus, der eine Stiermaske trägt. Schon zuvor war Ariadne im Labyrinth gewesen, die das Ende des Fadens um die Hörner der schlafenden Minotaurus gelegt hatte.
Rainers „Minotaurus“ liegt am Boden, er scheint zu kriechen. Der rote „Faden der Ariadne“, ein Wollknäuel, liegt auf dem Boden, das Ende umgibt seinen Kopf wie eine blutende Wunde. Er spricht Texte aus der Ballade von Dürrenmatt. Die Situation im Spiegellabyrinth wird nicht abgebildet, der Raum ist kahl und leergeräumt. Was der Minotaurus wahrnimmt, erfährt der Betrachter aus dem Text. Nur dort gibt es das Labyrinth und die Spiegelungen und die Täuschungen des Minotaurus, aber so suggestiv, dass man beim Hören (und Lesen) geneigt ist, sich selbst mit dem stummen Beobachter im Irrgarten zu identifizieren. Dies und der kahle Raum, der für alle denkbaren Räume steht, in denen der Stiermensch hilflos umhertappt, folgt aus dem fragmentarischen Zusammenspiel von Skulptur und Sprache.
Bienen
Mit dem Orang-Utan gedachte Josef Rainer die Beschäftigung mit dem Thema „Affen“ zu beenden, doch wird es wohl nur eine vorläufige Unterbrechung sein, denn das Thema ist unerschöpflich. Jetzt aber lockt ein anderes interessantes Lebewesen. Rainer hat begonnen, sich mit der Biene zu beschäftigen, und man darf gespannt sein. Redende Büsten werden da wohl kaum entstehen, aber es gibt andere Möglichkeiten, die der Sprachgebrauch und die menschliche Erfahrung im Umgang mit Bienen liefern. Außerdem ist die Biene ein symbolisches und daher literarisches Tier. Bienen gelten als fleißig, aber auch gefährlich, denn sie haben einen giftigen Stachel. Daher können sie positiv, aber auch negativ beurteilt werden – in ikonographischen Lexika findet man beide Varianten. Ihr interessantestes Produkt ist der Honig, eine überaus wohlschmeckende, eigentlich für den Bienen-Nachwuchs vorgesehene Substanz. Er ist süß und schmeckt darüber hinaus sehr erfreulich nach den Blüten, aus denen die Bienen den Nektar gesogen haben. Das sorgt für reichhaltigen gleichnishaften Gebrauch des Honigs. Ein honigsüßes Lächeln allerdings steht schon auf der Kippe, denn es kann falsch und hinterhältig sein, also verlogen. Sonst aber ist die Süße des Honigs unverdächtig. So vergleicht Mario Bettini (1582-1657) in seinem Werk Apiaria Universae Philosophiae Mathematice, also seinem philosophisch-mathematischen Bienenstock von 1642,21 die unaussprechlichen Wonnen der Mathematik mit der Süße des Bienenhonigs. Tatsächlich handelt sein Buch ja von der beliebten „Unterhaltungsmathematik“, von den Ludi mathematici,22 die damals auch den Künstlern allerhand Vergnügen bereiteten. Als der florentinische Maler Ucello (1397-1475) zu später Nachtstunde von seiner Frau ermahnt wurde,er solle doch endlich ins Bett kommen, soll er geantwortet haben, er sei gerade mit la dolce Prospettiva beschäftigt, sie möge sich noch gedulden, worauf die Frau auf diese Konkurrentin mit dem seltsamen Namen eifersüchtig wurde. Mit der „Süße“ dieser geometrischen Errungenschaft meinte er natürlich die des Honigs, mit dem die Geometrie ohnehin etwas zu tun hat, denn die aus regelmäßigen Sechsecken – also sechskantigen Säulen – zusammengesetzten Waben sind schöne Beispiele für die in der Natur überall vorhandene Mathematik. Bettini bildet denn auch eine Wabe mit einer Biene als Muster ab23, und in einem großen Kupferstich eine ganze mathematische Landschaft aus geometrischen Körpern mitsamt einem Bienenschwarm. Er versäumt nicht, auch die Illustration eines großes Spinnen-Netzes hinzu zufügen, ein bewundernswürdiges „Tragwerk-Gespinst“24. Eigentlich wäre auch die kunstreiche Spinne eine geeignete Kandidatin für Josef Rainer. Welche Möglichkeiten die Züchtung von Spinnen bietet, hat kürzlich der sachkundige Berliner Künstler Thomas Gorochowski in einem Berliner Museum demonstriert.25 Die dreidimensionalen zarten Gewebe bilden zauberhafte Strukturen eines imaginären und lebendigen Kosmos, der sich im Licht unablässig wandelt und weiterwächst. Indessen hat Rainer sein Bienen-Abenteuer gerade erst begonnen, und zwar mit lebenden Völkern. Sie bewohnen zwei Kästen, einer gehört ihm und einer seiner Frau. Er berichtet, dass sich diese Bienen trotz der Gleichartigkeit ihrer Lebensumstände sehr verschieden verhalten. Vielleicht liegt das an den Zeichen, mit denen die Kästen geschmückt sind. Rainer hat die Abbildung eines Bienenstocks aus einem Kalligraphischen Musterbuch Kaiser Rudolfs II. mit der dazugehörigen Devise gewählt26, seine Frau das indische Om für die Kräfte des Universums.
Wer den Bienen, ob kaiserlich oder indisch, auf die Spur kommen will, wird dazu neigen, sie und ihre Gewohnheiten „im eigenen Garten“ zu beobachten. So wird über den anglikanischen Bischof John Wilkins, einen Universalgelehrten des 17 Jahrhunderts27, berichtet, dass er sich durchsichtige Bienenkörbe bauen ließ, um das geheimnisvolle Werk der Bienen beobachten zu können. Wilkins war erfinderisch, er schrieb einen berühmten Roman einer Reise zum Mond, und entwarf eine Universalsprache und eine Enzyklopädie. Ob ihm die Mathematik auch so honigsüß vorkam wie seinem Zeitgenossen Bettini, ist nicht überliefert, aber nicht unwahrscheinlich. Da er wohl wissen wollte, wie Honig entsteht, wird man alchimistische Interessen vermuten dürfen.
Wenn wir auf der Zeitskala etwa eineinhalb Jahrtausende oder vielleicht noch ein paar Jahrhunderte mehr zurückwandern, dann treffen wir wieder auf den anderen, vielleicht größten Erfinder von allen, den Meister Daidalos, den antiken Künstler-Halbgott. Wir sind ihm bereits im Personenverzeichnis von Josef Rainer begegnet als Erfinder des Labyrinths und der Kuh der Pasiphaë. Auch er interessierte sich für Bienen und Waben. Er soll Bienenwaben in Metall gegossen haben, wahrscheinlich in Gold, was im Prinzip nicht besonders schwierig ist, in der Praxis aber einige Subtilität erfordert. Sie gerieten so gut, dass Bienen kamen, um sie zu füllen. Das aber war nur ein Vorspiel als Übung in „verlorener Form“. Als nächstes gelang es ihm, vollständige Bienen zu gießen. Wieder ummantelte er das Objekt, nun die Biene, mit feinstem Tonschlicker – mit dem auch die griechischen Vasenmaler ihre Zeichnungen auf das Gefäß auftrugen – dann kamen stufenweise die gröberen Materialien für die Form. Beim Brennen der Form verbrannten alle organischen Bestandteile, und das flüssige Metall verteilte sich in die Hohlräume bis in die feinsten Insektenhaare und angeblich auch in die von den Flügeln hinterlassenen dünnen Höhlungen. Daidalos hatte, wie es in dem Bericht heißt, die sterblichen Bienen durch seine überlegene Technik unsterblich gemacht.28
In der antiken Tradition spielt freilich wohl der Honig wegen seiner Süße die Hauptrolle. Ein prominenter Honigdieb war Amor, der ja auch für andere Süßigkeiten des Daseins zuständig war. Er stahl eines Tages eine Wabe voll Honig aus einem Bienenstock. Darauf attackierten ihn die verärgerten Bienen und stachen den kleinen Missetäter. Er beschwerte sich bei seiner Mutter Venus darüber, dass so kleine Wesen so große Schmerzen zufügten. Venus allerdings machte ihn darauf aufmerksam, dass er selbst ja mit seinen Pfeilen schon vielen großen Menschen Schmerzen bereitet habe. Die kleine Geschichte mit ihrer einfachen Moral hat der griechische Dichter Theokritos in seinen Idyllen erzählt. Sie war seit dem frühen 16. Jahrhundert ein beliebtes Bildthema und eine willkommene Gelegenheit, die nackte Liebesgöttin darzustellen – sehr bekannt sind einige Variationen von Lukas Cranach dem Älteren. Von Albrecht Dürer gibt es eine schöne Zeichnung in einem Klebeband des Kunsthistorischen Museums.29 Da kommen vor allem der dichte Bienenschwarm und die gefährliche Lage des kleinen Jungen, der heulend zu seiner Mutter flüchtet, zu ihrem Recht.
Gar nicht lustig geht es bei den merkwürdigen Imkern von Pieter Breughel d.Ä. zu.30 Die Bienenzüchter sind unheimliche Gestalten. Mit ihrer Schutzmaske unter der Kapuze sind sie gesichtslos. Einer der drei Männer wendet seinen Kopf so, als blicke er direkt auf den Betrachter. Der unsichtbare Blick wirkt bedrohlich, auch sieht es so aus, als fühle sich der Imker bei einer heimlichen Tätigkeit ertappt. Den Bienenkorb hat er unter den Arm geklemmt. Er will ihn wegtragen, vielleicht stehlen. Auch der Mann zur Rechten beschäftigt sich mit einem Bienenkorb. Ein dritter Korb liegt vorne im Gras. In der Mitte steht einer aufrecht und untätig, so, als sei er der Chef. Es ist nicht unverständlich, was sie tun und warum: Sie wollen die Körbe an einen anderen Ort bringen, wo die Bienen ihre Blüten finden werden. Aus den noch kleinen Blättern an den Bäumen kann man schließen, dass es Frühling ist. Der Mann oben im Baum ist wahrscheinlich ein Nesträuber, der Vogeleier sucht. Darauf bezieht sich auch die Inschrift: „Wer weiß, wo das Nest ist, der weiß es, wer es raubt, der hat es.“ Es gibt keine Undeutlichkeit in der Zeichnung. Dennoch bleibt eine Ungewissheit. Allzu unheimlich wirken die hantierenden Imker. Auch scheint ihr Tun sprachlos und lautlos. Diese absolute Stille wird nicht einmal vom Summen einer Biene unterbrochen. In Breughels Imkerbild sieht man keine einzige Biene. Doch auch das ist verständlich: Die Immen werden in ihren Körben transportiert. Schwärmen dürfen sie erst an ihrem zukünftigen Ort. Vielleicht ist das Ganze eine Allegorie voller Symbole, aber ungewiss ist, um welche Allegorie es sich handeln könnte. Solche Bilder liebte der große Kunsthistoriker mit dem Namen Deutobold Allegorowitsch Mystifizinski.31
Das Thema „Bienen“ ist, wie die Stichproben zeigen, ebenso universal und labyrinthisch wie das Affenthema. Auch ganz unabhängig von Honig und Geometrie ist schon das Verhalten der Biene (ihre Tanzsprache zum Beispiel) überaus interessant. So kann man beobachten, dass die Bienen von Blume zu Blume fliegen, aber nie den Blütenkelch ganz leer saugen. Ernst Jünger (1895-1998) hat das als Hinweis auf den richtigen Umgang mit der Natur gesehen und in seinem Roman Gläserne Bienen 32 behandelt. Die gläsernen Bienen sind kleine Flugobjekte, Automaten, die Nektar sammeln wie die richtigen Bienen. Sie dienen der industriellen Produktion von Honig. Aber sie saugen den Kelch vollständig aus und lassen nichts für andere übrig. Das ist ein Gleichnis für eine vernichtende Ausbeutung der Natur, so bewundernswert die fortgeschrittene und zu ganz unwahrscheinlicher Perfektion entwickelte Technik der Mini-Automaten auch sein mag.
Ich bin nun sehr gespannt auf die Erlebnisse Josef Rainers und seiner Gefährtin mit dem Bienenthema, und auf das, was die Bienen selbst in seiner Kunstkammer anstellen werden.
| top |
02. Emanuele Guidi und Elena Basteri. The Caption Problem ( La voce del Didascolo)
Ipotesi di scrittura per immagini Emanuele Guidi in collaborazione con Elena Basteri L’origine di questo testo è da rintracciarsi in un “problema”, come dichiarato nel titolo stesso: il problema della didascalia, o più precisamente della sua assenza. Una proposta per riflettere sulla mancanza dell’apparato che illustra e contestualizza il soggetto ritratto in un’immagine, lasciando quindi una fotografia - un documento - alla mercé dello sguardo o della possibile riscrittura. Una riflessione che già era emersa nel contesto della mostra di Gareth Kennedy Die Umbequeme Wissenschaft (ar/ge kunst, 2014) quando alcune fotografie ritrovate, grazie a Josef Rainer, in archivi privati in Sud Tirolo, sono emerse nella loro problematicità e fragilità proprio perché sprovviste di una descrizione che le accompagnasse. Altre immagini, rinvenute in pubblicazioni scientifiche, erano state pubblicate prive delle informazioni necessarie a comprendere il contesto in cui erano state prodotte e dunque volontariamente svuotate di quella ideologia che le aveva “commissionate”.Senza entrare nel dettaglio del progetto di Kennedy che porterebbe ad affrontare altre questioni, ho voluto rintracciare in quell’episodio il momento in cui ho avuto modo di conoscere approfonditamente Josef Rainer, la sua disinteressata passione per la ricerca artistica e l’intransigente curiosità verso il suo territorio – quello sudtirolese. Caratteristiche che emergono nella sua pratica e in molte sue opere attraverso un gesto ricorrente di “riduzione della scala” che produce uno spostamento del punto di vista, alla ricerca di una prospettiva “altra” e obliqua rispetto alle macro-narrazioni e storytelling che accompagnano oggi il marketing della città contemporanea e del paesaggio “naturale”; una “deriva” verso il microscopico, l’animale, l’infanzia come sguardi da recuperare e soprattutto come modi di leggere, come pratica attiva e produttiva (De Certeau), che creino uno spaesamento in una regione dove la narrazione intorno all’Heimat è difficilmente affrontabile in toni leggeri e tantomeno ironici. Josef Rainer sembra riuscire in questo. Se le ultimissime teorie che ricollocano la centralità dell’essere umano in rapporto all’ambiente e alla conoscenza, possono essere riviste in chiave “fiabesca”, allora le opere di Josef Rainer possono essere un ingresso privilegiato in questo modus pensandi dove temi come il lavoro, paesaggio urbano e rurale, scrittura e oralità non sono più esclusivo dominio dell’uomo. Un modo di pensare a cui chiaramente Josef Rainer stesso è approdato facilitato dal contesto culturale alpino che ha una tradizione estremamente prolifera in questo senso. La proposta per questo testo parte quindi anche dall’osservazione del progetto grafico di questo libro d’artista, dalla scelta di intrecciare le opere e la loro documentazione fotografica, secondo una logica soggettiva, senza bisogno di mediazione, racconto o giustificazione. Come scrive Paulus Rainer nella sua introduzione: “This presentation of the artist’s work comes along as a work of art in itself.” E in questi termini, ho voluto accogliere e portare avanti la sua tesi: “And as such it can be added to, changed, and, above all, interpreted in different ways – or in other words, its very form allows it to be decoded, like the individual works within it”. Andando a costruire sull’assenza di un vero e proprio apparato didascalico che illustri le opere rappresentate, questo testo – scritto a quattro mani con Elena Basteri - fa della didascalia il mezzo e la forma della scrittura stessa, offre delle ipotesi di legenda in cui far convergere riferimenti, bibliografie e citazioni attraverso cui espandere il significato delle opere stesse (o meglio della loro rappresentazione). Non necessariamente suggerendo un’interpretazione univoca e coerente ma al contrario inseguendo un approccio polemico e contraddittorio, apparentemente frammentato, attraverso quei campi semantici che Josef Rainer compone soggettivamente alla ricerca di nuove “sinergie”.
Un’ultima nota riguarda la presenza dello scrittore e poeta n.c. kaser (scritto abbreviato e in lettere minuscole come apparentemente desiderava firmarsi), a cui Josef Rainer ha dedicato una scultura nella piazza del municipio di Brunico, e che ha inserito in questo libro per ultima, quasi fosse una nota a piè di pagina che permetta di chiarire un percorso compiuto. Una scultura che sembra affrontare le questioni che riguardano la narrazione della città e il ruolo dei monumenti, anch’essi forme di scrittura per la città, interrogandosi sulla legittimità di chi è eletto a simbolo della collettività. Una statua a n.c. kaser fa emergere il paradosso del monumento: celebrazione e fragilità coesistono nell’atto stesso dell’”essere in pubblico”. È kind des wetters (figlia del clima) come n.c. kaser ha descritto la sua terra nella sua Lied der Einfallslosigkeit (Canto della povertà di idee); è esposta agli agenti esterni – atmosferici, politici, economici… - esposto alla rilettura, alla riscrittura, alle commemorazioni e alle vandalizzazioni che sono insite nella idea stessa di monumento e spazio pubblico. Celebrare un poeta come n.c. kaser significa dunque abbracciare l’anti-eroico e dare voce all’alterità come Josef Rainer ha spesso fatto con le sue sculture; significa cercare di mettersi nella posizione del “didascalo” – etimologia della parola didascalia – che nell’antico teatro greco era il secondo autore, raramente riconosciuto, che dava voce al coro: contraltare, alternativo e parallelo al testo del poeta ufficiale.
Opere: da pagina 12 a 25
Propolis Propolis: s. f. o m. [dal lat. propŏlis, gr. πρόπολις, propr. «ingresso, dintorni d’una città», comp. di προ- «avanti» e πόλις «città»]. – La derivazione greca, “davanti alla città”, suggerisce l’idea di difesa di un habitat da pericoli dal mondo circostante. La Propolis, infatti è utilizzata come barriera da agenti esterni nocivi. Le api rivestono con la Propolis le arnie o le cavità in cui hanno costruito il loro alveare e ne sigillano le fessure. Sostanza resinosa, bruna, prodotta dalle gemme degli alberi, che le api rielaborano e adoperano per chiudere fori e interstizî dell’arnia, per attaccare i favi e verniciarli, e per renderli immuni da attacchi di batterî e funghi. Già nota agli Egizî, che la utilizzavano nell’imbalsamazione, e ai Greci che l’adoperavano per accelerare la cicatrizzazione delle ferite.
Fonte: vocabolario Treccani
Sisterhood “No one had a clue until modern genetics that a hive is a radical matriarchy and sisterhood: all bees, except the few good-for-nothing drones, are female and sisters.”
”If she [The Queen] could think, she would remember that she is but a mere peasant girl, blood sister of the very nurse bee instructed (by whom?) to select her larva, an ordinary larva, and raise it on a diet of royal jelly, transforming Cinderella into the queen. By what karma is the larva for a princess chosen? And who chooses the chooser?”
Kevin Kelly, Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World, Basic Book, 1992
Memento Mori “Respice post te! Hominem te esse memento! Memento mori!” (Guarda dietro a te. Ricordati che sei un uomo. Ricorda che devi morire! In Tertulliano, Apologeticus, capitolo 33. Durante la parata che celebrava un trionfo militare, il generale romano vincitore veniva affiancato da uno schiavo incaricato di sussurargliquesta frase all’orecchio per impedire che fosse sopraffatto dalla superbia.
Opere: da pagina 33 a 51 / 70 – 71 / 76 – 77
Scrittura e Città “Per fare una deriva, andate in giro a piedi senza meta od orario. Scegliete man mano il percorso non in base a ciò che sapete, ma in base a ciò che vedete intorno. Dovete essere straniati e guardare ogni cosa come se fosse la prima volta. Un modo per agevolarlo è camminare con passo cadenzato e sguardo leggermente inclinato verso l'alto, in modo da portare al centro del campo visivo l'architettura e lasciare il piano stradale al margine inferiore della vista. Dovete percepire lo spazio come un insieme unitario e lasciarvi attrarre dai particolari.” Guy Debord, Théorie de la dérive, in Les Lèvres nues, n. 9, novembre 1956, Bruxelles
“La lettura presenta al contrario tutti i tratti d’una produzione silenziosa: un andare alla deriva attraverso le pagine, una metamorfosi del testo mediante il vagare dello sguardo, un’improvvisazione e un’attesa di significati dedotti da alcune parole, uno sconfinamento degli spazi scritti, una danza effimera…” “Un mondo diverso (quello del lettore) s’introduce nello spazio dell’autore. Questa mutazione rende il testo abitabile come un appartamento in affitto. Trasforma la proprietà dell'altro in un luogo occupato, per un momento, da un passante…”… “come infine i pedoni, che infiorano le strade con i loro desideri e i loro interessi”. Michel de Certeau, L’invenzione del Quotidiano, 1980
“Potrei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scale, di che sesto gli archi dei porticati, di quali lamine di zinco sono ricoperti i tetti; ma so che già sarebbe come non dirti nulla. Non di questo è fatta la città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato: la distanza dal suolo d’un lampione e i piedi penzolanti d’un usurpatore impiccato; il filo teso dal lampione alla ringhiera di fronte e i festoni che impavesavano il percorso del corteo nuziale della regina; l’altezza di quella ringhiera e il salto dell’adultero che la scavalca all’alba… gli strappi delle reti da pesca e i tre vecchi che seduti sul molo a rammendare le reti si raccontano per la centesima volta la storia della cannoniera dell’usurpatore, che si dice fosse un figlio adulterino della regina, abbandonato in fasce lì sul molo.” Italo Calvino, La città e la memoria. 3. In Le città invisibili, 1972
Ne travaillez jamais (Arbeit? Niemals / Non lavorate mai)
Graffito di Guy Debord scritto su un muro in Rue de Sein, Parigi, 1953
Opere: da pagina 52 a 59
Tierprozess
Ab dem 14. bis ins 17. Jahrhundert gab es gerichtliche Prozesse gegen Tiere, etwa gegen verwilderte Schweine, die Kinder angegriffen hätten, Hunde, Wölfe, Rinder oder Pferde, die sonst wie Schaden anrichteten. Hintergründe solcher Auffassungen waren unter anderen die europäische Rezession, verstärkte Häretikerverfolgungen, Inquisition, Integrierung des Offizialprozesses, Folter zur Wahrheitsfindung und die Ausweitung der Leibesstrafen. Tiere konnten bei einer Verurteilung gehenkt, verbrannt, ertränkt, erwürgt oder lebendig begraben werden. Manchmal, wie in Bern 1478, klagten die Bürger Maikäferlarven (Engerlinge) an und die Insekten erhielten tatsächlich einen Fürsprecher, der ihre Belange erklären sollte. Inwieweit man aber tatsächlich dachte, die Tiere hätten Verständnis für Anklage und Richterspruch, ist unklar. aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Tierprozess.
Opere: da pagina 60 a 69 La Scimmia Perfetta Le teorie sull'anatomia umana di Galeno (129 d.C. Pergamo in Asia Minore, Roma 200 d.C) che hanno fatto scuola per più di tredici secolo, fino al Rinascimento, si basavano in realtà sulla vivisezione di animali, in particolare di scimmie e scimpanzé. Non potendo, per ragioni morali e religiose, vivisezionare corpi umani: “Galeno dichiara all’inizio della sua opera Anatomicae Administrationes che l'oggetto della dissezione sarà la scimmia più simile all’uomo (scimmia perfetta, akribes pithekos). Galeno mostra di poter disporre di un numero considerevole di scimmie da sezionare. Tuttavia egli considera la possibilità che il suo lettore non disponga di scimmie, e perciò ammette l'uso di altri animali. In ciò Galeno seguiva la tradizione anatomica greca. Anche per Rufo la scimmia è l'animale più simile all’uomo; seguono gli animali dotati di dita, poi quelli a zoccolo fesso (ruminanti), e infine quelli a zoccolo intero (equidi).” Ivan Garofalo, Note filologiche sull'anatomia di Galeno, 1994)
Ein ganz junger Hund
„Ich erinnere mich an einen Vorfall aus meiner Jugend, ich war damals in einer jener seligen, unerklärlichen Aufregungen, wie sie wohl jeder als Kind erlebt, ich war noch ein ganz junger Hund, alles gefiel mir, alles hatte Bezug zu mir, ich glaubte, daß große Dinge um mich vorgehen, deren Anführer ich sei, denen ich meine Stimme leihen müsse, Dinge, die elend am Boden liegenbleiben müßten, wenn ich nicht für sie lief, für sie meinen Körper schwenkte, nun, Phantasien der Kinder, die mit den Jahren sich verflüchtigen“.
(Franz Kafka, Forschungen eines Hundes, 1922)
Opere: da pagina 72 a 75
n.c. kaser “Due anni fa, d'agosto, seppellivamo nel cimitero di Bruneck (Brunico) il dissidente sudtirolese Norbert Conrad Kaser. Al suo funerale c'era molta gente: donne di campagna, qualche frate cappuccino e diversi altri preti - molti un po' strambi ed alcuni malvisti dalla gerarchia - l'ipocrita sovrintendente scolastico Kofler e molti compagni, artisti, buona parte del "dissenso sudtirolese", qualche sindacalista e qualche esponente di partito.”
“Quasi del tutto assenti, dal funerale di Norbert Conrad Kaser, gli italiani ed i giovani: entrambi ignari della portata e del significato della rottura che N. C. Kaser (come amava abbreviarsi) aveva osato nel 1968-69, con la sua pubblica accusa della non-cultura sudtirolese ufficiale, con la sua feroce ironia contro una borghesia bottegaia ed un clero oppressivo”… “Norbert era morto d'isolamento all'età di 31 anni: sempre più profondamente immerso nell'alcool e nello sforzo estremo di scuotere, di comunicare qualcosa, di graffiare. Non gli piacevano le avanguardie troppo spinte: con le femministe di Bruneck aveva polemizzato per una scritta irriverente sui muri della chiesa e nel 1976 si era iscritto, senza mai contrarvi nulla, nel PCI, quasi a dimostrare che non voleva restare solo”…“Fu al funerale di Norbert che decisi di tornare nel Sudtirolo, che non si volevano altri morti, che bisognava fare qualcosa”. Alexander Langer, Funerale laico con Tedeum 1.8.1980, Lotta Continua, agosto 1980
Macchine da scrivere (per la città) L’8 Marzo 2019, Milano: la statua che rappresenta Indro Montanelli seduto con la macchina da scrivere appoggiata sulle ginocchia, opera di Vito Tongiani, viene ricoperta di tinta rosa dalle attiviste del movimento Non una di Meno. Un segno di protesta rispetto al passato del giornalista che ai tempi della occupazione in Eritrea aveva acquistato e avuto una relazione sessuale con una bambina di 12 anni. Un passato mai rinnegato dal giornalista stesso.
| top |
03. Hans Georg Holländer G.H.H.. Von Riesen und Zwergen, Minotauren und Affen, Bienen und Waben
Immer wollt ich eine Ape haben. Seit ich zum ersten Mal in Italien war, zog mich nicht die Vespa an, sondern dieser dreirädrige Kastenwagen mit dem winzigen Führerhaus, der das mühelose Wegtragen eines viel zu großen Gepäcks versprach. Sein Verhalten ähnelt dem der Vespa, von der er abstammt, nicht dem des Urbilds eines Lastendreirads, des Goliaths, den ich nur einmal im Leben leibhaftig sah, an der Steinlach in Tübingen, als lebendes Fossil. Das war vor einem halben Jahrhundert und bleibt wegen des blanken Erstaunens im Gedächtnis, mit dem ich damals die grüne Saurierschnauze eines evolutionären Versehens betrachtete. Vielleicht ging ich noch an der Hand meiner Mutter. So lange ist das also her. Jetzt gehen wir auch Hand in Hand, weil sie sich auf mich stützt. In einer Ape hätten wir zusammen keinen Platz.
Ape, die Biene, Vespa, die Urwespe, Piaggio, der Schöpfer, dessen Name, härter ausgesprochen, ich gefalle bedeutet. Ein italienisches Wortfeld also, in dem frech der englische Ape herumturnt, sich hinter den Steuerknüppel schwingt, ungerührt von Zurufen, haltet ihn! pass doch auf! Der Affe in der Ape, der Ape und die Biene, so verbindet sich zu einem Bild, was, ganz unterschiedlich groß, in der Sprache zusammentriftet. Groß und klein, klein und groß, alles ist nur eine Frage der Perspektive. So ist die Biene ein kleines Dreirad, in dem der Affe größer wirkt, als er ist, in dem aber vor allem jeder zum Affen wird, der sich ins Führerhaus zwängt. Auf dieses Erstaunen umstehender Menschen habe ich mich immer gefreut, wenn es mit affenartigem Geschick doch gelingt, sich da hineinzufalten und dann, auf schmalen Straßen und weiten Plätzen, in geschwindem Übermut das Auf und Ab des unberechenbaren Geländes zu überwinden und manchmal ein
Stück weit zu fliegen. Denn das hat die Ape, wenn sie leicht beladen ist, von der Vespa, ihrer kleineren, keinen Honig heimtragenden Schwester, dass in ihr der Affe im Fahrer allzeit glücklich wird. Den Affen, den unbelehrbaren, bewahren die bescheidenen Möglichkeiten seiner Biene vor übermäßigen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung, weil sie nur mehr tragen kann, als ihr eigentlich zuzumuten ist. Eigentlich ist sie also ein Esel. Vom Goliath dagegen erwartet jeder, riesige Lasten zu ertragen, dann aber fällt er, was öfter passiert ist, plötzlich um, unweigerlich, das sagt schon sein Name. Der Ape passiert das nicht, die ist zu klein, um gefährlich zu stürzen, jedenfalls glaube ich das fest.
Damit haben wir schon eine Geschichte erzählt, in der alle Figuren erscheinen, mit denen Josef Rainer sich spielerisch auseinandersetzt, groß und klein, Kindheit und Erwachsensein. Sich lesend zu bilden wie die Affen, die den Grafen von Monte Christo oder die Metamorphosen vor sich haben (genau die!), Dante oder die Forschungen eines Hundes (eben!), Gebilde zu erzeugen, die aus fleißigen Lesefehlern entstehen, gehört zu seiner Spielanordnung. Ihren heimlich fortentwickelten Regeln folgt er mit der Ernsthaftigkeit von Kindern, die beim Spiel Regeln finden, um sie jederzeit wieder umzustoßen, wenn die Anderen nicht darauf passen oder es schon bemerken, aber so tun, als ob.
Als Schiedsrichter auf hohem Stuhl balanciert lebensgroß, auf einem Tischgerüst, der Lehrer mit der Schreibmaschine und dem Manuskript, das aus der Walze emporquillt. Der Lehrer oder doch der Dichter oder doch ein Lehrer. Ein leerer Stuhl steht seinem hohen gegenüber, auf dem sie platznehmen dürfen, Schüler oder Zuhörer oder Leser, wenn sie sich in aller Öffentlichkeit dazu getrauen. Der leere Stuhl steht ein wenig weggerückt, dahin schaut der hoch Geehrte mit bronzenem, ursprünglich gipsernem Blick und denkt. An Schüler. An Leser. An Kritiker nicht oder nur mit vorweggenommenem Ärger ... jetzt mueßte der kirschbaum bluehen ... verrueckt will ich werden & bleiben ... eine zahme kraehe moecht ich Dir
sein ... herrenlos brennt die Sonne ... meine floete trinkt musik ... der mensch hat immer schon geschrien ... der Zufall der Bibliographie reiht die Sätze aneinander, die den hohen Stuhl und den Blick des Dichters und die überquellende Schreibmaschine beglaubigen. Den Affen gibt sie Lesefutter. Erst noch ungebildet, verwandelt sich das Gegenüber des Dichters vom Affen zum Leser.
Norbert Conrad Kaser.
Gestorben 1978 in Bruneck, geboren 1947 in Brixen, Lehrer auf Dörfern, wo er als Sonderling unterkam, ehe Josef und Paulus zur Schule gingen. Ein Dorfschullehrer mit Schreibmaschine. Einer Olivetti natürlich. Eine Ape heißt auch nicht Dreirad, sie ist dreirädrig, das schon, aber so, wie eine Olivetti selbst schon inspiriert war, hat die Ape ihren eigenen Willen.
Dinge leben auch.
Was ist lebendiger, die Biene oder die Wabe? Eben. Das lässt sich nicht entscheiden. Vielleicht ist die Wabe schon totes Material und die Biene nicht tot, aber die Wabe wächst und die Biene eigentlich schon nicht mehr, wenn sie Wachs bearbeitend Waben baut und summt. Das Summen ist ganz wichtig. Denn Kinderlieder schreiben kann nur, wer summen mag. Damit fing das Schreiben an. Später kamen die Anschläge der Olivetti oder der Olympus oder wie die mechanischen Geräte hießen, die es dem Dichter leichter machten, die eigene Handschrift zu verleugnen und seine Sprache zugleich von jeder Angleichung zu entfremden.
Im Schriftbild seiner Texte zeigt der Dichter, ob er einen eigenen Kopf hat und wenn ja, welchen. Einen Rindskopf zum Beispiel. Rinder sind die anderen Bewohner des Dorfes, zahlreicher als die Menschen dort, also steht der Rindskopf dem Dichter, der zu möglichst vielen sprechen mag, auch auf die Gefahr hin, dass ihn die Bauern für ein Rindvieh halten.
Auf dem breiten Rand einer Schale oder eines tiefen Tellers sitzt der so da und redet mit einem blonden, womöglich weiblichen Gegenüber. Minotaurus. Ein lesender Affe sitzt wem gegenüber, Adam? Die Schale wird
zum Hut, eine Schlange ringelt sich daraus empor, ein Clown versinkt in der Krempe, drüben ragen die Füße heraus. Allein balanciert er auf dem Tellerrand. Ein Lehrer, wendet er sich bloß an die Köpfe von Schülern.
Aus diesem bemalten und glasierten Tongeschirr ließe sich frühstücken. Löffelnd legte das Kind den Grund der Schale frei, kratzte über Grund und Rand und versuchte, den letzten Rest Haferflocken von der Glasur zu lösen, für seine lüstende Zunge unerreichbar. Dem Affen gelänge es, das Geschirr ganz auszulecken. Seine Zunge ist lang. Wie lang ist seine Zunge? Sehr lang, glaube ich. Die Figuren am Tellerrand führen ein gesprächiges Dasein. In ihrer Welt, die sie nicht zu verlassen brauchen, sind sie sich selber Riesen. Draußen wären sie Zwerge.
Der Affe, wenn er lesen gelernt hat, sieht aus wie Darwin. Dessen Lippen sind nachdenklich verschlossen, während der Affe redet. In einem Kopf sind sie einander verbunden. Janusköpfig ist das, aber wer blickt zurück, wer nach vorn? Vielleicht gehört die Zukunft dem gelehrigen, dozierenden Affen, die Vergangenheit dem Forscher, der alle Einsicht aus ihr und nicht aus dem Unerfahrenen bezieht. Diese doppelgesichtige Büste aus Gips, mit blauem Hemd und farbigen Augen könnte in Bronze vollendet werden. Eine Form würde dann hergestellt und mit Bienenwachs ausgegossen, mit kleinen Gusskanälen, die der flüssigen Bronze den Weg weisen und sie gerecht verteilen, innen gäbe es einen Kern aus Ton, der nach dem Guss, wenn das Wachs verdampft und die Bronze erstarrt ist, ausgeschlagen werden kann. Das hat die Gipsbüste immer vor sich. Auch die Bronze ließe sich bemalen, falls das noch nötig wäre. Das nennt sich Wachsausschmelzverfahren. Mit dem Wachs kommen wieder die Bienen ins Spiel, ohne die ein Bronzeguss nicht denkbar ist. In ihren Waben verbergen sich Reiterstandbilder und Bathsebas im Bade, alles eben, was sonst aus Stein oder Holz gehauen werden müsste, vom Künstler, der Imker sein oder wenigstens einen Imker wissen muss, der ihm zu Feuer und Metallfluss reines Bienenwachs liefert. Imker und Künstler, das wäre ein anderer Januskopf, der Imker als Affe oder
der Affe als Imker und Darwin als Künstler, der den Stoff des Lebens ausspinnt. Auch umgekehrt lassen die Rollen sich zuordnen. Vieles erweist sich bei näherem Hinsehen als janusköpfig, das einen einzelnen Kopf zu haben scheint, ob Evolution oder Inspiration, Schöpfung und Entwicklung. Beides verkörpert sich hier.
Wer ist lebendiger, die Zwerge vorn oder die verschwommenen Riesen im Hintergrund dokumentarischer Photographien aus dem Leben seiner Spielfiguren? Josef Rainer stellt sie mitten ins Leben als Beobachter, Spaziergänger, Gefangene, Mitspieler hinein, immer bedroht von Riesenfüßen und Riesenkörpern, unter denen sie sich ungerührt bewegen, wie andere Kleinlebewesen auch, die in Furcht erstarren müssten, wären sie sich der Riesen in ihrer Umgebung stets bewusst. Sie haben ihr Liebes-, Arbeits-, ein Nachtleben, sie spielen und erinnern uns daran, was das Spiel einmal war. Denn alle waren wir einmal klein und sind es immer noch, sobald wir Fußgänger bleiben oder allenfalls eine Ape oder eine Vespa lenken und der Bedrohung durch deutsche Lenkwaffen, Autos, zu entgehen suchen, deren geheimer Zweck es ist, Fußgänger langsam, aber sicher auszurotten.
Josef Rainers Liliputaner gehen zu Fuß. Kinder gibt es unter ihnen auch. Sie wissen Hand in Hand zu gehen. Manche sind Arbeiterdenkmäler, die Arbeit verkörpern, ohne einen Handschlag zu tun. Menschen also. Manche spielen Büchsenfußball. Alles nicht wie, sondern mehr als das wahre Leben. Ach. So.
Das Kleine kann auch deshalb klein erscheinen, weil es sehr weit weg und in Wirklichkeit, aber was heißt da Wirklichkeit? riesengroß ist. Riesengroß wie ferne Sterne, die als blitzende Punkte den Nachthimmel durchlöchern oder sie, verhältnismäßig klein, als Planeten umkreisen. Viel kleiner als sie ist der Kopf des Astronomen, der ihre Größe zu ermessen fähig ist. An seiner Büste, die aus Metall gehämmert eher als gegossen scheint, stecken sechs Kugeln oder Planeten, die es erlauben, Augen, Zunge,
Hals, Kopf zu bewegen. Tycho Brahe. Er irrte auf eine grandiose Weise und sah die Planeten um die Sonne und diese wieder um die Erde kreisen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Sternbilder verbergen sich in seinem Kopf, mögliche und unmögliche.
Liliputaner gehen im Umriss eines solchen Sternbilds spazieren, umarmen sich, lesen Zeitung. Einen Freizeitsternbildschatten wirft das schlank überlängte Standbild einer Frau aus Gips, mit rotgefärbten Lippen, nackt und nur mit einem Morgenmantel behangen. Ein Staatskörper? Europa? Ein Sternbild, in dem wir zu leben hoffen, in dem es eine Freizeit gibt, in der wir lieben und tun können, was anderen nicht schadet, anders als dort, wo Freizeit der Unterdrückung derer dient, die keine haben. Josef Rainers Liliputaner denken nicht daran, dem Schatten der Riesin Fesseln anzulegen. Sicher trägt sie den Namen Gulliver. Das klingt nach Möwen und offenem Meer. Europa Gulliver. Das Meer gibt dem Land seine Form. Das Meer umgibt Europa auch dort, wo gar keines ist. Um den Schatten, in dem die Liliputaner leben, erstreckt sich ein unbetretbares Gebiet, wo es mit dem Tod zugeht. Zum Glück sind sie nicht lebendig. Sie sind tot wie die Waben tot sind, die immer noch wachsen, je nachdem, was die gerade lebenden Bienen antreibt. Die Wabe kann tatsächlich als Staatskörper gelten, gestaltet als Arbeit, nicht als Gefäß der überschüssigen, sondern der völlig verwerteten Zeit also, die nicht zur Freizeit und im Zeitunglesen oder Spazierengehen verfliegt.
Natürlich ist das keine Kunstkritik. Was die Kunst als verlorene Form hergibt, gieße ich aus, ohne Anspruch auf eigenes zu erheben, was der Dichter immer nur dann tut, wenn er gar keiner war. Das Eigene findet sich im Umgang mit dem Anderen. Es gehört den Lesern, so wie die Kunst allen gehört, die vertraulich mit ihr umgehen.
G. H. H.
04. Paulus Rainer. The Daedalus Principle
ON PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA SQUARE IN FLORENCE, TOURISTS WHILE THE HOURS AWAY BY COUNTING THE NUMBER OF BEES BUZZING AROUND THE SOCLE OF THE EQUESTRIAN STATUE OF FERDINANDO I DE’ MEDICI. THE BRONZE SLAB DEPICTS A MAXIM BY THE GRAND DUKE: BELOW MAIESTATE TANTUM (BY MAJESTY ALONE) A SWARM OF BEES CIRCLES THE QUEEN BEE IN FIVE CONCENTRIC CIRCLES. THE ARTISTIC ASYMMETRICAL ORDER OF THE BEES CREATES A SHIMMERING EFFECT AND IMPAIRS COUNTING: ONLOOKERS TEND TO LOSE THEIR POINT OF REFERENCE AND HAVE TO START FROM SCRATCH. WE’LL SWOOP IN RIGHT NOW AND GIVE THEM A HELPING HAND: THERE ARE NINETY BEES AND ONE QUEEN BEE. THE LATTER CERTAINLY SYMBOLISES THE KIND RULER WHO RULES OVER THE CITY BY MEANS OF HIS NATURAL GRANDEUR.Bees have always flitted in works of art as symbolic vessels: swarms were used as an example to represent a society’s structure, and individual bees were considered laborious and just. Their commitment to work for the common good was exemplary and their honeycombs were proof of their organised and orderly, if somewhat geometrical, mind. However, the insects were also linked to outbursts of anger and contentiousness. The abovementioned traits were all transposed, symbolically of course, from human beings onto animals – they were considered hybrids. Hybrids because when shifting human traits onto animals, or vice versa, we enter a symbolic domain ruled by mixing, crossing, and uniting the human and animal kingdoms. These limbos knew how to stir the interest of people and beguile their creativity throughout the ages, and even influenced the Mannerism movement. Take the speaking witnesses represented in the four-volume picture manuscript by Joris Hoefnagel depicting animals. Volume I is the Animalia Rationalia et Insecta, where animals and insects are gifted with reason and assigned to the elemental force of fire; the tome reveals a representation of Petrus Gonsalvus, a ‘Haarmenschen’ (a particularly hirsute man) and his wife. Gonsalvus suffered from hypertrichosis (also called Ambras syndrome), and was ‘welcomed’ to the French Court of Henry II as an ‘ape man’. He was schooled, brought up, and married to the daughter of a Court worker. With his animal-like looks stuffed into court livery, he walks the line between the human and animal kingdom. Back then he would have been considered a member of both worlds, therefore a hybrid. However, Daedalus himself was a master of hybrids. The mythological artist and inventor whose sculptures were considered constructs imbued with a soul, which could walk and see, created an artificial cow for the wife of King Minos: she used the vessel to beget the son of a bull. ‘And by means of the ingenuity of Daedalus Pasiphaê had intercourse with the bull and gave birth to the Minotaur, famed in the myth. This creature, they say, was of double form […]’ recounts Diodor.
Daedalus’ construct was used to overcome nature: thanks to his creation, the bull considered the king’s wife as one of its own. The result of this deception was the creation of a hybrid. When Theseus killed the creature, Daedalus had to turn into a hybrid: he had been banned by the incensed King Minos to the Labyrinth, as the inventor had given Ariadne a wool spool which helped Theseus escape from the maze. To flee from his prison, Daedalus created wings for his son and himself with which both – now half man, half bird – soared into the skies. As we all know, his son Icarus plunged into the ocean, while Daedalus made it to Sicily where he created another hybrid for the goddess of love, Aphrodite: a golden honey comb, which was so similar to a real one that it was filled with honey by bees. However, it only became an actual hybrid through the aforementioned task. Daedalus created different types of hybridisation thanks to his art: his sculpting breathed life into inanimate objects, although this didn’t automatically make them hybrids.
His imitation of nature as well as his tampering created mixed beings, and he turned himself and his son into a hybrid, and the bees transformed his golden honeycomb into a hybrid. This balancing act on the cusp between man and nature with occasional preference from one side to the other is what we could call the Daedalus principle. Josef Rainer exploits this principle, yet he turns it on its head: art doesn’t improve, swap or overcome nature, rather nature refines his art. In his Bienen-Arbeiten he has found a kindred soul in these animals, for they complement his work. Just like Daedalus, he’s created a golden honeycomb which was recognised by a swarm of bees as an ideal storage unit. However, at first, the bees busied themselves by smoothing out irregularities in the metal mould; small irregularities and errors when the mould was cast were improved diligently with wax until the storage unit could be occupied to give birth to the larvae. Before, Josef Rainer had created a small-sized version of a bronze skull which was modified in the same way by the bee swarm. The insects became sculptors, covering the metal skeleton with wax muscles and skin. Modifying existing forms all started with a project of a whole, glass brain, where the bees – that was the main aim of the artist in the first place – should have built their own honeycomb; their task would have been to turn the inner structure of the human brain into a hexagon, the only shape they could imagine. The natura naturans of bees didn’t touch the interior of the brain, rather modified it with stable honeycombs, thus becoming a protective cover for the skull. This is where the creative nature of the uniform working swarm came to light, as the artist gave them the space and opportunity to do so. He’s a mere observer of the act of creation.
He elevates himself into a sphere which differs from that of an active creator, shifting into a world where he becomes a fire starter, a person causing the first spark. Goethe’s The Sorcerer’s Apprentice fits in that same narrative: a person who fell prey to the intoxication of power due to his hubris and couldn’t rid himself any longer of his ghosts. The ghosts of Josef Rainer possess another nature. They’re not changed by magic like the mops of the apprentice, rather they remain unchanged and are merely invited by the artist to complete his work. And, from time to time, they do so in a way that make computer animated architecture seem old-fashioned (take the deconstructed completed painting of structure no.1). The bees unite the existing honeycomb tracks by using a morphing process, by building passages between these tracks. The material they build is once again set in a limbo between art and nature, reminiscent of many a cabinet of curiosity from Mannerism. Be it the coral branch covered in gold, where nature and art go hand in hand, the silver cicada or any of the folios from Hoefnagel’s abovementioned books, where two dragonflies are built using glued together insect wings and illusory bodies, what matters is that all these are hybrid works between nature and the work of man. The hybrids by Josef Rainer also belong to this group, even though his metamorphoses occur in other ways: the starting point is human art, which is not only refined by nature, but also completed by it. Ultimately, even this creation is a creature of the Daedalus principle.
From: "Synergien", Kerber Verlag, 2020
| top |
05. Paulus Rainer. Das Daedalus Prinzip
Auf der Piazza Santissima Annunziata in Florenz machen sich Urlauber gerne einen Spaß daraus, die Anzahl der Bienen zu zählen, die auf dem Sockel des Reiterstandbildes Ferdinandos I. de‘ Medici prangen. Die Bronzeplatte zeigt eine Imprese des Großherzogs: Unter dem Motto Maiestate Tantum (durch Majestät allein) schart sich ein Schwarm Bienen in fünf konzentrischen Kreisen um die Bienenkönigin. Die kunstvoll asymmetrische Anordnung der Bienen erzeugt ein gewisses Flirren und erschwert das Zählen: der Zählende verliert immer wieder seine Referenzpunkte und muss von vorne beginnen. Ihm sei hier geholfen, es sind neunzig Bienen – und eine Königin. Mit dieser ist natürlich der gütige Herrscher gemeint, der allein durch seine natürliche Erhabenheit regiert. In diesem oder ähnlichen Sinne fand die Biene als Bedeutungs- und Symbolträgerin immer wieder Eingang in die Kunst. Das Bienenvolk galt als Musterbeispiel für das Staatsgefüge, die einzelne Biene als arbeitsam und gerechtigkeitsliebend. Ihr Einsatz für das Allgemeinwohl konnte als beispielhaft hervorgehoben werden, ihre Wabenstöcke waren Zeugnis ihrer Fähigkeit zu geometrischer Ordnung und Organisation. Daneben wurden aber auch Jähzorn und Streitsucht mit den Insekten verbunden. All dies Eigenschaften, die vom menschlichen Wesen auf das animalische symbolhaft übertragen wurden – also gleichsam hybrid betrachtet wurden. Hybrid, weil wir bei der Übertragung menschlicher Eigenschaften auf das Tier - oder umgekehrt tierischer auf den Menschen - im Gedanklichen und Symbolischen einen Bereich betreten, der von Vermischung, Kreuzung und Bündelung der menschlichen und der animalischen Sphäre bestimmt ist. Diese Zwischenwelten waren es, die zu vielen Zeiten Interesse und Phantasie zu wecken wussten und auch den Manierismus befeuert hatten. Ein – im wahrsten Sinne – sprechendes Zeugnis ist dabei die Darstellung in einem vierbändigen Bildmanuskript von Joris Hoefnagel mit Tierdarstellungen. Den ersten Band, in dem die Animalia Rationalia et Insecta, also die vernunftbegabten Tiere und die Insekten dem Element des Feuers zugeordnet sind, eröffnet eine Darstellung des „Haarmenschen“ Petrus Gonsalvus und seiner Frau. Gonsalvus, der an Hypertrichose oder dem „Ambras Syndrom“ litt, war zunächst als Affenmensch an den französischen Hof Heinrichs II. gelangt, wo man begann, ihn zu erziehen, zu unterrichten und ihn mit der Tochter eines Hofbediensteten verheiratete. Mit seinem tierhaften Äußeren, das in höfischer Kleidung steckt, wandelt er hier auf dem Grat zwischen humaner und animalischer Welt. Zu seiner Zeit war er als beiden Welten zugehörig betrachtet worden, also als Hybrid.Der Meister des Hybriden war aber wohl Dädalus. Er, der mythologische Künstler und Erfinder, dessen Skulpturen man für beseelte Geschöpfe hielt, die gehen und sehen können, schuf für die Gemahlin des Minos eine künstliche Kuh, in die diese schlüpfen konnte, um sich mit einem Stier zu vergnügen. „Vermittels des Kunstwerks von Dädalus mit dem Stier begattet, gebar Pasiphaë den fabelhaften Minotaurus, ein Doppelwesen,“ wie uns Diodor berichtet. Das Kunstwerk des Dädalus war in diesem Fall also Instrument, um die Natur zu überlisten und damit zu überwinden. Durch Dädalus‘ Kunst betrachtete der Stier das menschliche Wesen als seinesgleichen, das Ergebnis dieser Täuschung war ein Hybrid. Als dieser von Theseus getötet worden war, musste sich Dädalus selbst zum Hybriden wandeln: Er war vom erzürnten Minos in das Labyrinth verbannt worden, da er Ariadne jenes Wollknäuel gegeben hatte, mit dessen Hilfe Theseus dieses Labyrinth verlassen hatte können. Um seinem Gefängnis zu entfliehen, formte Dädalus für sich und seinen Sohn Flügel, mit denen sich die beiden – nun halb Mensch, halb Vogel – in die Lüfte erhoben. Der Sohn Ikarus stürzte bekanntlich ins Meer, Dädalus gelangte aber nach Sizilien, wo er für die Liebesgöttin Aphrodite einen weiteren Hybriden schuf: eine goldene Honigwabe, die dermaßen täuschend echt war, dass sie von den Bienen mit Honig befüllt wurde. Zum Hybriden wurde diese Wabe freilich erst durch diesen Akt. Dädalus bediente mit seiner Kunst also verschiedener Formen des Hybriden: seine Bildhauerkunst hauchte toter Materie Leben ein, diese war aber noch nicht hybrid. Seine Nachahmung und Überlistung der Natur ließ hingegen Mischwesen gebären, sich selbst und seinen Sohn machte er zum flugfähigen Mischwesen und die Bienen vervollständigten seine Goldwabe schließlich ebenso zum Hybriden. Diese Gratwanderung auf der Klippe zwischen Mensch und Natur mit gelegentlichem Abdriften auf die eine oder andere Seite kann man hier als Prinzip des Dädalischen erkennen.
Dieses Prinzip macht sich auch Josef Rainer zunutze, doch dreht er es um: nicht die Kunst verbessert, täuscht oder überwindet die Natur, bei ihm soll die Natur seine Kunst verfeinern. In seinen „Bienen-Arbeiten“ hat er in diesen Tieren Verbündete gefunden, die dies für ihn übernehmen. Wie Dädalus schuf er eine goldene Wabe, die ebenso vom Bienenvolk als Lagerstätte für den Honig anerkannt wurde. Zunächst waren die Bienen aber damit beschäftig, Unregelmäßigkeiten im Metallguss zu korrigieren; kleine Divergenzen und Gussfehler wurden fleißig mit Wachs ausgebessert, bevor dann die Vorratskammer für den Nachwuchs bezogen werden konnte. Vorher noch schuf Josef Rainer einen verkleinerten Totenkopf aus Bronze, der genauso vom Bienenvolk umbaut wurde. Die Insekten wurden nun zu Plastikern, die das metallische Skelett mit wächserner Muskel- und Hautmasse überzogen. Dieses Umbauen vorgegebener Formen begann eigentlich mit dem Projekt eines hohlen, gläsernen Gehirns, in das die Bienen – so die Grundintention des Künstlers – ihre Waben bauen hätten sollen; sie sollten also dem Inneren des menschlichen Gehirns ihre Struktur, die man sich wohl nicht anders als sechseckig vorstellen konnte, verleihen. Die natura naturans der Bienen tastete das Innere des Gehirns aber nicht an, sondern umbaute es mit stabilen Waben, also einer schützenden Schädelhülle. Hier manifestierte sich nun das kreativ schöpferische Element des gleichförmig arbeitenden Schwarmes, dem der Künstler Raum und Recht verleiht, dies zu tun. Er selbst ist eigentlich nur mehr Beobachter des Entstehenden. Er erhebt sich dadurch in eine Sphäre, die nicht mehr jene des aktiven Schöpfers ist, sondern jene, in der lediglich die Initialzündung ausgelöst wird (firestarter). In derselben Ebene war wohl Goethes Zauberlehrling, der in seiner Hybris dem Machtrausch unterlag und seine Geister nicht mehr loswurde. Josef Rainers Geister sind aber von anderer Natur; sie sind nicht durch Zaubermacht verwandelt wie der Besen des Lehrlings. Sie sind unverändert und vom Künstler lediglich eingeladen, sein Kunstwerk zu vollenden. Und dies machen sie mitunter in einer Art und Weise, dass sie selbst computergenerierte Architektur alt aussehen lassen, wie etwa in dem dekonstruktivistisch vervollständigten Gebilde Struktur Nr. 1. Hier verbanden die Bienen vorgegebene Wabenbahnen wie in einem Morphing-Prozess, indem sie die Übergänge zwischen diesen Bahnen verbauten. Die von ihnen gebaute Materie ist also wieder in einem Zwischenbereich zwischen Kunst und Natur, in der sich auch viele Werke der manieristischen Kunstkammern bewegen. Ob dies nun der in Gold veredelte Korallenast ist, in dem Kunst und Natur Hand in Hand gehen, die in Naturguss abgeformte Silberzikade oder jenes bekannte Blatt aus dem oben angesprochenen Tierbuch Hoefnagels, auf dem zwei Libellen aus eingeklebten Insektenflügeln und illusionistisch gemalten Körpern gebildet werden – all dies sind hybride Werke aus Naturprodukt und menschlicher Zutat. Zu dieser Familie gehören auch die Hybride Josef Rainers, nur findet die Morphose bei ihm unter anderen Vorzeichen statt: Ausgangspunkt ist bei ihm die menschliche Kunst, die von der Natur nicht nur veredelt, sondern vervollständigt wird. Letztendlich ist aber auch das in diesem Sinn Entstehende ein Geschöpf des Dädalus-Prinzips.
Aus dem Katalog "Synergien", Kerber Verlag 2020| top |
06. Dr. Bettina Schlorhaufer. Perspective tordue
„Die Größe des Menschen ist reiner Zufall. Er gibt seiner Umgebung die Größe und weist ihr damit entsprechende Bedeutung zu“, sagt Josef Rainer. Seit einigen Jahren gestaltet er in seinem Atelier ungefähr 30 cm große Figuren. Sie bestehen aus einem Drahtgestell, das mit Gips überzogen und anschließend bemalt wird. Dann rückt er gemeinsam mit seinen Kunst-Agenten aus: in Industriegelände, Produktionshallen und Straßenräume, seltener in die freie Natur. Dort werden sie zum Leben erweckt: Paarweise schlendern sie Abflussrohre entlang. Zwei küssen sich heimlich zwischen Schwerarbeitern, die in einem Kraftwerk hantieren. An mehreren Orten sind die Männchen als Straßenarbeiter im Einsatz. Eine andere Gruppe hat Reinigungsdienst, sie kehrt und wischt. Dann gibt es da noch die archetypisch anmutende Figur eines entflohenen Sträflings, der über ein schneebedecktes Feld der Freiheit entgegenläuft.Josef Rainer fotografiert seine Inszenierungen. Später werden sie im Großformat ausgearbeitet und in Galerien ausgestellt. Manche der auf den Fotos vorkommenden Spielhandlungen werden dann gemeinsam mit Innenraum-Installationen präsentiert. Das ergibt einen Verdoppelungs-Effekt. Aber auch in den Ausstellungshäusern müssen die Kleinen hart arbeiten: Sie brechen den Galerieboden mit dem Presslufthammer auf oder sie scheinen den Besucherstrom mit Verkehrszeichen umzuleiten. Ein Männchen im Trenchcoat wurde mit einer Aktentasche ausgestattet. Er ist ins Büro geschickt worden, auf dem Weg dorthin trifft er auf seinen Doppelgänger. Er weicht ihm aber unerschrocken aus.In seinen Arbeiten stellt Josef Rainer eine Welt nach, in der das Kleine groß und somit scheinbar Unbedeutendes zu einer noch nicht da gewesenen Aufmerksamkeit gelangt. Dabei wirkt sich die krasse Verschiebung von Proportion und Perspektive irritierend auf die Wahrnehmung des Betrachters aus: Die kleinen „Puppen“ werden meistens in Augenhöhe fotografiert, aber anschließend in einem Format ausgearbeitet, in dem die Figuren wiederum ihre reale Größe von ca. 30 cm annehmen. Somit ist es vor allem der Vorgang des Umkehrens von Proportionen und Perspektive, der die Verunsicherung des Sehsinns hervorruft.Der Begriff perspective tordue (verdrehte Perspektive) wurde ursprünglich für die Kunst der Urzeit geprägt. Z. B. diente er im Bereich der Höhlenmalerei zur Beschreibung von Darstellungen, bei denen unterschiedliche Ansichtsarten gleichzeitig verwendet wurden. Kopf und Rumpf eines Tieres im Profil und seine Hufe frontal darzustellen, galt aber für lange Zeit als primitiv. Diese gering schätzenden Ansichten über prähistorische Kunst wurden erst durch so große Künstlerpersönlichkeiten wie Pablo Picasso korrigiert. Er bemerkte nach einem Besuch der Höhle von Altamira mit treffender Einfachheit – und natürlich auf den Kubismus bezogen: „Wir haben nichts dazugelernt.“Im Bereich des künstlerischen Arbeitens auf ebenen Flächen war es nicht immer von Bedeutung, zu einer dem menschlichen Sehen nahe kommenden Ausdrucksweise zu gelangen. Dennoch galt die Entwicklung der Linearperspektive seit der Frührenaissance als epochales Ereignis und wurde als revolutionärer Schritt am Weg zu einer realitätsnahen Kunst betrachtet. Mit ihrer Hilfe werden die Dinge so dargestellt, wie sie erscheinen, unabhängig von ihrer absoluten Beziehung zum Raum. Das ganze Bild stimmt aber nur, wenn der Betrachter einen bestimmten Blickpunkt einnimmt. Diese neu auftretende Raumkonzeption bedeutete auch einen Bruch mit mittelalterlichen Weltbildern. Die an ihrer Erfindung federführend beteiligten Künstler – unter ihnen Brunelleschi, Masaccio, Donatello und Leonardo – näherten sich ihrem Ziel einer wirklichkeitsgetreuen Darstellung, getrieben von wissenschaftlicher Neugierde. Doch sie waren auch Vertreter einer Gesellschaft, in der ein Grundgefühl des Individualismus auftrat. Bei den Künstlern bewirkte die neue Weltanschauung, dass die flächige Darstellungsweise des Mittelalters mit ihren Figuren in unklaren Aktionsräumen und in Schwebe bleibenden Beziehungen zueinander, zugunsten eines Kunstschaffens in richtiger Perspektive (ars perspetiva = durchblickende Kunst) aufgegeben wurde. In Zusammenhang mit dem Individualisierungsprozess der Renaissancegesellschaft waren die neuen Tendenzen in der Kunst deshalb von Bedeutung, weil sich die linearperspektivisch richtige Darstellung immer auf einen einzigen Blickpunkt eines individuellen Betrachters bezog. Nicht zuletzt hinterließ diese Ära auch in Bezug auf die Identität der Künstler Spuren. Nun sahen sie sich nicht mehr als Handwerker (im Auftrag Gottes), sondern als Wissenschaftler und schöpferisch tätige Kreative. Obwohl es keinen bestimmten Erfinder der Linearperspektive gab, wurde sie ohne Verzögerung mit großer Geschwindigkeit allgemein angewandt. Dabei scheint es, dass manche Künstler an der Erforschung ihrer Geheimnisse mit einem solchen Forscherdrang arbeiteten, dass ihr Ehrgeiz alsbald in schwärmerische Begeisterung überging. Z. B. ist von Paolo Uccello überliefert, dass er verzückt „Wie süß ist Perspektive!“ ausgerufen haben soll.Die Linearperspektive ist zugleich ein technisches Problem und eine ästhetische Aufgabe, deren Entwicklung auf eine Suche nach optisch vollkommenen Kunstwerken entstand: Die Bewältigung eines Themas sollte gleichrangig mit der räumlichen Entfaltung einer Bildkomposition und ihrer mathematisch exakten Umsetzung erfolgen. Das führte dazu, dass die Darstellungen anderer Kulturen und Epochen, in denen diese Regeln nicht im Vordergrund des künstlerischen Schaffens standen, als hässlich und ungeschickt betrachtet wurden – Beurteilungsgrundlagen, deren Qualitätskriterien erst seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ins Wanken gerieten.In Verbindung mit den auf Fotopapier gebannten Figuren von Josef Rainer macht der kleine Exkurs in die Geschichte der Perspektive deutlich, dass die in der Kunst der Gegenwart möglich gewordene Einnahme eines beliebigen Blickwinkels viele positive Seiten hat. Wie bei der allgemeinen Entwicklung ihres Begriffes schon mitberücksichtigt wurde, soll Perspektive nicht nur dazu dienen, die Welt so wiederzugeben wie sie ist bzw. erscheint, sondern sie soll Künstlern und Publikum den „Durchblick“ verschaffen. So gesehen bestimmt heute jeder Künstler individuell, welche Perspektive er bei der Gestaltung seiner Arbeiten einnimmt. Er nützt sie zur Darstellung seiner Sicht der Dinge.In diesem Zusammenhang ist Josef Rainers Position besonders interessant: Er nimmt für seine Fotografien vielfach die so genannte Froschperspektive ein. Er zielt aber nicht darauf ab, etwas fotografisch abzulichten, sondern geht mit Teilen seines Ateliers in die Umwelt hinaus, um etwas in ihr abzuspielen. Als Kind seiner Zeit ist er von den Medien Film und Fernsehen beeinflusst, weshalb er in seinen Arbeiten immer Drehbücher vorzuführen scheint: Im Atelier gestaltet er seine Typen (den Bauarbeiter, den Sträfling, die junge Frau usw.). Draußen, am Ort ihrer Implantierung in eine Szene, müssen sie ihre vorbestimmten Rollen einnehmen. Josef Rainer – selbst Drehbuchautor, Bühnenbildner, Regisseur und Kameramann – kümmert sich dann um die gesamte Abwicklung eines Kunstprojekts. Nur für die kleinen Kunst-Agenten gibt es kein Entkommen. Wie in Charlie Chaplins Film Modern Times sind sie den erbarmungslosen Mechanismen einer Welt industrieller Produktionsprozesse schutzlos ausgesetzt – perspective tordue?Aus dem Katalog: "Josef Rainer - Percorsi Urbani",
Bettina Schlorhaufer, Enrico Gusella, Josef Rainer, Padova, 2005| top |
07. Marion Piffer Damiani. Alla Periferia del Quotidiano
Josef Rainer lavora con i mezzi della fotografia (inscenata) e dell’installazione. Come un regista cerca il setting adatto alle sue riprese e lo trova nell’inosservata periferia delle cose e nelle topografie del quotidiano.L’artista non fissa lo sguardo sul piano del tavolo, bensì al di sotto di esso, sulle relative gambe; non guarda alla credenza e al lavello, bensì ai tubi di scarico. Dà un’occhiata alla paletta lasciata lì casualmente e contenente la spazzatura fatta di mozziconi di sigaretta, oppure ferma la sua attenzione su pistoni di macchine o banchi di comando in un impianto industriale. In mezzo a tutti questi diversi “accessori scenici” Josef Rainer colloca delle figure in gesso, modellate intorno a un’ossatura in fil di ferro, figure dipinte che presentano un’altezza di trenta centimetri circa.
Le figure in gesso colorato sono posizionate in relazione a dei reali oggetti di vita quotidiana come una gamba di tavolo, un predisposto secchio di colore oppure un vuoto scatolone di succhi di mela, che in questo contesto artistico nuovo e fittizio assumono dimensioni sorprendenti e surreali, trasformandosi in architetture e paesaggi eccentrici. Particolari reali dello spazio, frammenti d’architettura e casuali cose d’ogni giorno vengono letteralmente “riformattati” e, al contempo, trasformati nella loro funzione. La mise en scène trae la propria tensione da questo spostamento di proporzioni e dal complesso gioco di realtà e finzione.
Josef Rainer lavora con diverse forme di presentazione, a volte realizza un’installazione
di figure e oggetti quotidiani, altre, ricorre alla fotografia – dalla singola immagine alle articolate sequenze fotografiche – in bianco e nero o a colori e in differenti formati. In certe fotografie compare anche l’artista stesso e, come il gigante Gulliver, guarda il proprio universo di figure. Al centro del lavoro si pone un concetto dinamico di forma, che tematizza la complessità di relazioni fra spazio fuori e dentro l’opera, fra contesto artistico e realtà quotidiana, fra interno ed esterno, fra l’esistenza umana e il suo rapporto con l’universo.
Spesso caratterizzati dal gran formato, i quadri narrativi mostrano motivi facilmente comprensibili: persone che lavorano e comunicano, azioni e movimenti quotidiani in paesaggi urbani. Non accade nulla di straordinario; gli scenari sembrano noti, tratti dalla vita quotidiana. Sottoposte ad un processo d’astrazione, le figure senza volto incarnano la tipica noia della normalità, sempre accompagnata dalla tensione. L’inventario di un mondo di per sé familiare si presenta in una dimensione insolita, insolitamente estraneo come attraverso una lente d’ingrandimento, ma al contempo nuovamente allontanato, visto dall’alto come da un belvedere.
Josef Rainer costruisce le proprie immagini secondo il principio che, nel piccolo e nel secondario, si rispecchiano il grande e il tutto. I dettagli di cavi, tubi o condutture di una centrale idroelettrica o di una distilleria rappresentano le grandi tubazioni, le vie di trasporto e di comunicazione nel mondo esterno. Le figure in gesso vengono collocate nello spazio dell’immagine come fossero attrici o marionette, mentre i tubi di scarico si tramutano in un frammento d’ingegneria gigantesca. La convenzionalità dei protagonisti e delle azioni rappresentate ha l’effetto di una formula magica che conduce a una trasformazione semiotica: ciò che raggiunge uno scopo pratico nella quotidianità, diviene segno estetico nella rappresentazione artistica. Nelle installazioni e nelle fotografie, l’artista collega la forza d’astrazione del modello architettonico con la simbolicità dello scenario.
L’illusione cessa là dove comincia la metafora. Nel momento in cui il quotidiano (inscenato) diviene oggetto della rappresentazione artistica/estetica, ecco che la quotidianità va perduta. Non la consideriamo più come una circostanza data e indiscutibile, bensì come costruzione culturale nella relatività delle cose e dei loro nessi logici. Nelle immagini di Josef Rainer, le doppie drammaturgie del quotidiano (nell’allestimento e nella successiva rappresentazione fotografica) divengono allegorie di situazioni costruite, espresse in azioni quotidiane o “lavori quotidiani” come costruire, mettere in ordine, parlare. “Lavori quotidiani” come i lavori di un giorno feriale o “giorno lavorativo”, ma anche un lavoro da ultimare in diverse fasi come, per esempio, la pittura ad affresco (“giornate”).
Su un piano etimologico, la “quotidianità” ha a che fare con la ripetizione (ogni giorno) e con il tempo (giorno). Il “quotidiano” lo leghiamo alla routine, all’abitudine, a qualcosa che ci si attende a livello di percezione. I soggetti delle immagini di Josef Rainer ruotano intorno al quotidiano e smascherano quello che è il mero carattere potenziale di questa stessa quotidianità. La percezione del secchio di colore vuoto nell’atelier diviene letteralmente una questione di veduta, un problema di atteggiamento estetico rispetto all’atteggiamento quotidiano e, naturalmente, anche di poesia di quel pensiero magico che sta dietro allo stupore e alla gioia negli occhi dei bambini.
Auszug aus dem Katalog "Josef Rainer"
Hrsgr.: Marion Piffer Damiani, Folio Verlag, 2003| top |
08. Marion Piffer Damiani. An der Pheripherie des Alltäglichen
Josef Rainer arbeitet mit den Medien der inszenierten Fotografie und der Installation. Wie ein Regisseur sucht er nach dem passenden Setting für seine Aufnahmen und findet sie in der unbeachteten Peripherie der Dinge und Topographien des Alltags.Seinen Blick richtet der Künstler nicht auf die Tischplatte sondern darunter auf die Tischbeine, er schaut nicht auf die Anrichte und das Spülbecken, sondern auf die Abflussrohre. Er wirft ein Auge auf die zufällig abgestellte Kehrschaufel mitsamt dem Kehricht aus Zigarettenstummeln, ein andermal erwecken die Maschinenkolben oder Schaltpulte einer Industrieanlage seine Aufmerksamkeit. Inmitten all dieser unterschiedlichen „Requisiten“ platziert Josef Rainer um ein Drahtskelett geformte Figuren aus Gips, die bemalt und etwa dreißig Zentimeter groß sind.
Die farbigen Gipsfiguren beziehen Stellung zu realen Alltagsobjekten wie etwa einem Tischbein, einem beigestellten Farbkübel oder einem leeren Apfelsaftkarton, die in diesem neuen fiktionalen Kunstkontext überraschende surreale Dimensionen annehmen und sich in eigenwillige Architekturen und Landschaften verwandeln. Reale Raumdetails, Architekturfragmente und zufällige Alltagsdinge werden im wörtlichen Sinn „umformatiert“ und zugleich umfunktioniert. Die Mise en Scène bezieht ihre Spannung aus dieser Verschiebung der Größenverhältnisse und dem beziehungsreichen Wechselspiel von Realität und Fiktion.
Josef Rainer arbeitet mit unterschiedlichen Präsentationsformen, er setzt wahlweise eine Installation mit Figuren und Alltagsobjekten ein, dann wieder Fotografie - vom Einzelbild zu mehrteiligen Bildsequenzen – in Schwarzweiß oder in Farbe und in unterschiedlichen Formaten. In manchen Fotografien tritt der Künstler auch einmal selbst in Erscheinung und blickt wie ein Riese Gulliver auf seine eigene Figurenwelt. Im Zentrum der Arbeit steht ein dynamischer Formbegriff, der die Komplexität der Beziehungen zwischen Raum und Bildraum thematisiert, zwischen Kunstkontext und Alltagswirklichkeit, von Innen und Außen, zwischen der menschlichen Existenz und ihrem Verhältnis zum Universum.
Die häufig großformatigen narrativen Tableaus vermitteln leicht begreifbare Motive: arbeitende und kommunizierende Menschen, alltägliche Handlungen und Bewegungen in urbanen Landschaften. Da ereignet sich nichts Außergewöhnliches, die Szenerien scheinen aus dem alltäglichen Leben gegriffen, bekannt. Die gesichtslosen abstrahierten Figuren verkörpern die typische mit Spannung gepaarte Langeweile alltäglicher Normalität. Ungewöhnlich fremd wie durch ein Vergrößerungsglas und zugleich doch wieder entfernt wie vom Aussichtsturm herab präsentiert sich ungewöhnlich dimensioniert das Inventar einer an sich vertrauten Welt.
Josef Rainer konstruiert seine Bilder nach dem Prinzip, dass sich im Kleinen und Nebensächlichen das Große und Ganze widerspiegelt. Details von Kabeln, Rohren oder Leitungen eines Wasserkraftwerks oder einer Destillerie repräsentieren die großen Rohrleitungen, Transport- und Verbindungswege draußen in der Welt. Der Künstler setzt die Gipsfiguren in den Bildraum wie Schauspieler oder Marionetten, die Abflussrohre daneben mutieren in ein Fragment gigantischer Ingenieursbaukunst. Die Konventionalität der Protagonisten und der dargestellten Handlungen wirkt als Zauberformel für die semiotische Transformation: Was im Alltag einen praktischen Zweck erfüllt, wird in der künstlerischen Repräsentation zum ästhetischen Zeichen. Der Künstler verbindet in seinen Installationen und Fotografien die Abstraktionskraft des Architekturmodells mit der Symbolizität des Bühnenbildes.
Wo die Metapher beginnt, hört die Illusion auf. In dem Augenblick wo das (inszenierte) Alltägliche zum Gegenstand künstlerischer/ästhetischer Repräsentation wird, ist es um die Alltäglichkeit geschehen. Wir nehmen sie nicht mehr fraglos als gegebenen Sachverhalt an, sondern als kulturelle Konstruktion in der Relativität der Dinge und ihrer Sinnzusammenhänge. Die doppelten Dramaturgien des Alltäglichen (in der Inszenierung und anschließenden fotografischen Repräsentation) werden in den Bildern von Josef Rainer zu Gleichnissen konstruierter Gegebenheiten, ausgedrückt in alltäglichen Handlungen oder „Tagwerken“ wie Bauen, Aufräumen, Reden. „Tagwerke“ wie die Werke eines Wochentages oder „Werktages“ aber auch ein abschnittsweise fertig zu stellendes Werk wie etwa Malerei in Freskotechnik („giornate“).
Etymologisch hat „Alltag“ mit Wiederholung zu tun (alle Tage) und mit Zeit (Tag). Das „Alltägliche“ verbinden wir mit Routine, Gewohnheit, auf der Wahrnehmungsebene mit Erwartetem. Die Bildsujets von Josef Rainer kreisen um das Alltägliche und entlarven dieselbe Alltäglichkeit als eine doch nur potentielle. Die Wahrnehmung des leeren Farbkübels im Atelier wird im wörtlichen Sinn zur Ansichtssache, zur Frage einer ästhetischen gegenüber einer alltäglichen Einstellung – vielleicht auch des magischen Denkens hinter staunenden ungeplagten Kinderaugen.
Textauszug aus dem Katalog: "Josef Rainer"
Hrsgr: Marion Piffer Damiani, Folio Verlag, 2003| top |
09. Sigrid Hauser. Bilder mit Folgen
Zur Architektur in der Kunst von Josef Rainer01.31/05
Die Koinzidenz von Realität und Fiktion zeigt sich zum Beispiel am Bild einer STADT, indem im Rahmen des Kunstraums und mit der Sprache der Fotografie Darstellungen von Inszenierungen – modellhaften, prototypischen, objektiven – als Situationen festgehalten sind, im großen Maßstab, das heißt auf stark vergrößerten Fotoaufnahmen. Da haben die Protagonisten und ihre Protagonistinnen auf einer Fläche von etwa fünf mal zwei Meter die Größe von mehr als einem Meter, es sind über einem Eisendraht aus Gips geformte und bemalte Figuren, sie sind in ihrer Realität gut dreißig Zentimeter groß, ihre Architektur besteht aus diversen Gegenständen des Alltags: Farbdosen, Getränkekartons, Holzkisten mit aufgeschraubten Metallgriffen, Zigarettenstummeln. Diese Dinge aus unserer Realität werden auf den fotografisch abgebildeten Situationen im Verhältnis zu den mehr als einen Meter großen Figuren zu entsprechend großen Architekturfragmenten, die Kombination ergibt somit in dem jeweiligen Ausschnitt eine Verfremdung, eine Verwandlung von Größenverhältnissen, der Künstler zeigt uns für den ersten Blick ein Spiel mit Proportionen.02.03/06
Im Rahmen des Kunstraums kommuniziert diese fotografische Aufnahme an der Wand mit der Installation des dreidimensionalen Modells der Gipsfiguren selbst, sie sind in ihrer Realität gut dreißig Zentimeter groß, ihre Architektur besteht aus diversen Gegenständen unseres Alltags: Farbdosen, Getränkekartons, Holzkisten mit aufgeschraubten Metallgriffen, Zigarettenstummeln. Der tatsächlich gültige Maßstab ist nicht festzulegen, zumal an der Wand des Kunstraums andere Fotos in anderen Größen unter anderem diese Situation darstellen, aber auch an den Wänden des dargestellten Stadtstücks wiederholen sich diese Szenen, als seien hier Plakate, Annoncen oder ähnliches affichiert worden, darauf zum Beispiel die Szene, in der der Künstler, hinuntergebeugt, vor dem Absperrzaun einer Baustelle, mit seinen eigenen Gipsfiguren, die da offensichtlich mit einer Schaufel in der Hand arbeiten, Kontakt aufnimmt. Die Tafel am Zaun unmittelbar hinter dieser Szene zeigt die an solchen Orten üblichen Piktogramme, die Verbote und Gebote in den üblichen Farben meinen und mit verschiedenen Sprachen erläutern.03.03/06
Die Protagonisten und ihre Protagonistinnen im Raum und auf der etwa fünf mal zwei Meter großen Fotoaufnahme an der Wand lassen eine Erzählung vermuten, besser gesagt mehrere Erzählungen, je nachdem, welche Zuschauerin sich da manches zusammenreimt, je nachdem, welcher Zuschauer sich da etwas denkt dabei: Wer die Hauptpersonen sind und wer einfache Statisten, das ist schwer auszumachen, jedenfalls entsteht zwischen den Begrenzungen eine Art Wegenetz, das Bewegung illustriert. Die Grenzen definieren auch Konturen von Plätzen, wo angehalten wird, wo man sich trifft, wo man stehenbleibt, wo man rasch um die nächste Ecke biegt, wo man gesehen werden will oder eben nicht, wo man sich hinsetzen kann, endlich, und zuschauen: Da reinigt nämlich einer den Boden von überlebensgroßen Zigarettenstummeln, ein anderer plakatiert das Foto eines Kunstraums, ein dritter pinselt mit Hilfe eines vierten die weiße Kunstwand an – welche Farbe das werden wird, ist nicht klar, die Aktion hat soeben begonnen. Ein Paar umarmt sich in einer Ecke, ein anderes biegt um eine andere, ein einzelner und ein zweiter – möglicherweise haben sie einen gemeinsamen Auftrag – fotografieren einen Teil der Situation. Im Hintergrund arbeiten zwei Arbeiter mit ihren Schaufeln: Sind es nicht die Darsteller auf dem vorhin erwähnten Plakat, der Annonce oder ähnliches? Der eine trägt jedenfalls die gleiche hellblaue Mütze mit weißem Streifen. Bleibt noch zu erwähnen die Mutter mit dem Kind an der Hand, es hält einen gelben Luftballon, und dahinter spielen andere Kinder und Jugendliche, sie sehen nicht jünger aus als die restlichen Figuren, nur etwas kleiner sind sie geraten, sie spielen Fußball, Hockey und rollen mit Skateboards. Die Beteiligten sind gewissermaßen alterslos, niemand von ihnen hat ein Gesicht, sie haben wohl Andeutungen von Nasen, nicht aber Augen, Ohren und Mund. Alles in allem wird da eine Stadtsituation festgehalten, die weder besonderes Glück noch besonderes Elend, auch keine anderen besonderen Eigenschaften verrät, es passiert sozusagen nichts, zumindest nichts Wesentliches im Moment, um die Ecke biegt allerdings ein schwarz-gekleideter Mann mit schwarzem Hut auf dem Kopf: hält er nicht einen Koffer in seiner rechten Hand? Das könnte der Anhaltspunkt sein, den Szenenverlauf nochmals von vorne zu rekonstruieren.04.01/06
Der Maßstab stellt das Thema dar: Annäherungen, Beziehungen, Nötigungen, Umarmungen, Versöhnungen und andere Auseinandersetzungen. Welche Größe ist hier relevant? Oder: wo sind hier die Grenzen des Kunst-Raums? Und: wie nahe sind diese in unserer Realität? Und weiter: sind auch wir Teile dieser Installation, ist unser Zuschauen in diesen Themen inbegriffen? Und weiter so: was ist Einbildung, was entspricht der Wirklichkeit?05.06/06
Diese Fragen drängen sich nicht von ungefähr auf, ist doch in anderen Projekten der Künstler selbst die Figur, die den Maßstab bestimmt und verwandelt: Daß er bereits im Bild der STADT auf einem an eine Holzkisten-Architektur angebrachten Plakat vor einem Absperrzaun einer Baustelle Kontakt zu zwei arbeitenden Gipsfiguren aufnimmt – er muß sich, damit dies gelingt, ziemlich hinunterbeugen –, davon war bereits weiter oben, wie üblicherweise geschrieben steht (wo auch immer das ist, auf den Bergen im Hintergrund oder bereits in den Wolken), die Rede, der menschliche Maßstab wird somit höchstpersönlich mit dem Maßstab der Kunst konfrontiert.
...
Textauszug aus Katalog "Josef Rainer"
Hrgr.: Marion Piffer Damiani, Folio Verlag, 2003| top |
10. Sigrid Hauser. Image with Sequels
On Architecture in the Art of Josef Rainer01.31/05
Reality and fiction coincide, for example in the image of a CITY where staged scenes—prototypical, objective, and model-like—are presented in the framing of an art space and by means of the language of photography as large-scale situations, which is to say as highly enlarged photo images. As seen on a surface some five meters wide and two meters tall the protagonists show a height of more than a meter. These are painted plaster figures on wire frames, standing in reality some thirty centimeters tall; and their architectural surroundings consist of various objects from daily life: paint cans, beverage cartons, wooden crates with screwed-on metal handles, cigarette butts. In these photographic situations, and juxtaposed to figures more than a meter tall, these objects from our day-to-day environment accordingly turn into large fragments of architectures; and in any given scene the combination results in an alienation, a shift in relationships of scale. We see at first glance that the artist is presenting a game he plays with proportions.02.03/06
In the framing of the art space, this photographic image displayed on the walls communicates with the installation of three-dimensional models of the plaster figures themselves. The figures in reality are some thirty centimeters tall, their architectural surroundings consist of various objects from daily life: paint cans, beverage cartons, wooden crates with screwed-on metal handles, cigarette butts. The actual, factual scale of things cannot be determined: on the walls of the exhibition space, there are also other photos, in other sizes, that show this scene, among others. And on the walls of the represented cityscapes, these scenes are found again, as though pasted up as posters, announcements, or advertisements, or something of the kind, showing for example a scene in which the artist bends down in front of the barrier at a construction site to make contact with his plaster figures, who apparently are working there, with shovels in their hands. The panels on the fence directly behind this scene show the kinds of pictograms which are found customarily in such places, with their regulations and prohibitions announced in their standard colors, and in various languages.03. June 3
The protagonists that stand in the space and appear on the walls in photographic images some five meters wide and two meters tall allow us to imagine the telling of a story, or, better, of any number of stories, depending on whatever any particular viewer will make of things; on whatever will cross the mind of any other particular viewer. On who the main character is likely to be; on who amounts simply to a walk-on. That’s hard to figure out. But in any case, there are borders and limits and between them a network of paths and roads that exemplify a movement. These borders as well define the outlines of places: where people stop and stand, or meet each other, or hang around, or quickly turn the corner, or want to be seen or not seen, or can take a seat, finally, and have a look around. Over there is a man who is cleaning the floor of larger than life-size cigarette butts. Another is erecting a photo poster of an art space. A third with the help of a fourth is painting a white partition: the color it will be is not yet clear, the action has only just begun. A couple embraces in a corner; another couple is turning a corner; a man alone, and as well another—perhaps they’ve both been hired for the same job—is taking photos of a part of the situation. In the background, two workers are at work with shovels: aren’t they the very same models who appear on the posters, announcements, or advertisements, or something of the kind, just mentioned above? One of them in any case is wearing the same pale blue cap with a white stripe. Mention, moreover, remains to be made of the mother holding her child by the hand, a child in turn who’s holding a yellow balloon, and behind the child another group of children, and perhaps teenagers. They look no younger than the other figures, are simply a little bit smaller: they’re playing soccer, and hockey, and riding skateboards, in a way they’re ageless: none of them have a face: they have hints of noses, but no eyes, ears or mouths. We’re looking all in all at an urban situation that betrays no particular happiness, nor special misery, nor any other particular quality. More or less nothing is happening, as it were, or surely nothing essential at this particular moment. Still, however, a man dressed in black, with a black hat as well, has just appeared from around the corner: is that a suitcase he carries in his right hand? That could be a starting point from which to reconstruct the scene, beginning again from the beginning.04. June 1
The theme is the theme of proportions and measurements: approaches, relationships, solicitations, embraces, forgivings, and other confrontations. What’s the relevant scale, here? Or, where are the borders of the art space? And what’s the distance at which we find them within our own reality? Or again: are we ourselves parts of this installation? Is our viewership, spectatorship, included among its themes? And further: what’s imagined, and what belongs to reality?05. June 6
These questions don’t come out of nowhere. There are also other projects in which the artist is himself the figure that establishes and alters the scale of things. Already in CITY we find him on a poster on an architectural structure made of wooden crates where in front of a barrier at a construction site he’s apparently trying to contact two plaster figures of workers (to bring it off, he has to bend quite far down) and this too, already above, as the saying goes—wherever that “above” may be, in mountains that tower in the background, or even already in the clouds—gave rise to the thought that human scale is thus confronted, and in highly personal terms, with the scale and standards of art....
Textauszug aus Katalog "Josef Rainer"
Hrgr.: Marion Piffer Damiani, Folio Verlag, 2003